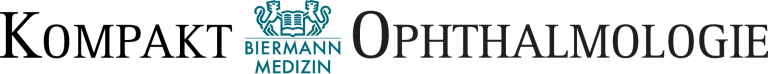13. Mai 2024
YOKOHAMA (Biermann) Bei Brolucizumab (BCZ) handelt es sich um einen VEGF-Inhibitor, bei dem ein erhöhtes Risiko für eine intraokuläre Inflammation (IOI) besteht. Wie die Autoren einer aktuellen Arbeit nun berichten, führt eine Therapie mit Corticosteroiden (CS) in einem frühen Stadium der IOI zu einer günstigen visuellen Prognose. Die Wissenschaftler überprüften