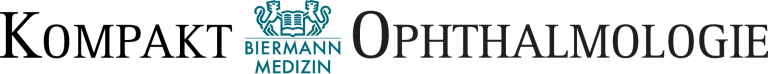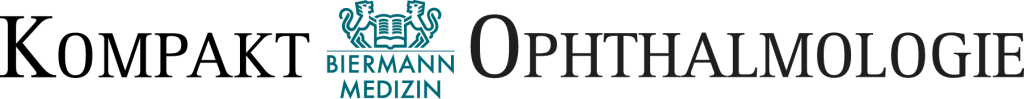Sehr geehrte Leserinnen und Leser von Kompakt Ophthalmologie,
alles neu macht der Mai, heißt es ja eigentlich – jetzt kam aber eine wirklich wichtige neue Veröffentlichung über ein neuartiges Kunstlinsenmaterial bereits im April. Und es war glücklicherweise kein Aprilscherz.
Schickhardt et al. aus Heidelberg veröffentlichten gerade im „Journal of Mechanical Behavior of Biomedical Material“ eine wichtige Publikation über eine neuartiges Linsenmaterial. Es handelt sich dabei um ein crosslinked Polyisobutylen der chinesischen Firma Eyedeal. Hierbei handelt es sich um ein hydrophobes Material, aus dem eine monofokale Linse hergestellt wurde. In der Augenheilkunde wurde das Material schon im Glaukombereich genutzt, jedoch noch nicht für Kunstlinsen. Mehrere Jahrzehnte hat sich im Bereich der Materialforschung für Kunstlinsen nicht viel getan. Neben PMMA, Silikon und Hydrogel bestimmten hydrophile und hydrophobe, elastische Acrylate den Markt. Das erste Implantat, durch Ridley im Jahre 1949 eingesetzt, bestand aus einem starren Acrylat. Dieses Material bestimmte den Markt bis Ende des vergangenen Jahrhunderts. Die IOL-Materialien auf Acrylatbasis lösten dieses Material ab und dominieren derzeit den Markt, da sie gegenüber früheren Materialien mehrere Vorteile bieten, wie z. B. die Flexibilität, welche Kleinschnitttechniken ermöglicht, sowie optimale optische und chemische Eigenschaften. Diese führen zu einer guten Biokompatibilität und zur langfristigen Stabilität im Auge. Glücklicherweise sind daher z.B. Eintrübungen von Kunstlinsen, die eine Explantation notwendig machen, eine Rarität geworden.
Die Forscher untersuchten in der umfangreichen Veröffentlichung u.a. die Materialqualität mithilfe eines beschleunigten Alterungsprozesses, um ein mögliches Glistening nachzuweisen. Als Kontrolllinse diente dazu die Acrysof Linse von Alcon. Hierbei erwies sich das neue Material als deutlich besser im Vergleich zum AcrySof-Material. Außerdem wurde die Oberfläche mittels Rasterelektronenmikroskopie untersucht, wobei sich eine sehr gute Beschaffenheit zeigte. Die vorliegende Brechkraft im Vergleich zum Labeling und die MTF-Funktion wurden ebenfalls mittels OptiSpheric IOL PRO2 analysiert und erfüllten die ISO-Standards mit guten Werten für photopische und skotopische Pupillenweiten. Auch hierbei zeigten sich gute Ergebnisse, welche mit der Vergleichslinse kompatibel waren. Ein weiterer interessanter Parameter in der Materialforschung ist der sogenannte „contact angle“. Dieser beschreibt physikochemische Eigenschaften wie z. B. die Hydrophobizität. Mit 97,2° liegt dieser Wert für die Eyedeal Linse sehr nah am Optimum von 100° und deutlich über dem Wert der AcrySof von 73,3. Ein hoher Wert ist u. a. mit einem geringeren Risiko für eine bakterielle Besiedlung verbunden, wodurch sich die Sicherheit bei einer Kunstlinsenimplantation mit diesem Material erhöhen könnte.
Des Weiteren bieten der hohe refraktive Index, die hohe Abbe-Zahl und die gute Elastizität des Materials weitere Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Materialien. In Zukunft können damit möglicherweise größere Optiken bei kleineren Inzisionsgrößen ermöglicht werden. Dies wiederum könnte Nachtfahrprobleme wie Halo und Glare etc. insbesondere bei weiten skotopischen Pupillengrößen verringern und auch den Einfluss des chirurgischen Zugangs auf die Hornhaut und den Heilungsverlauf positiv beeinflussen. Da bei kleineren Inzisionen weniger Hornhautnerven durchtrennt werden, könnte möglicherweise auch das postoperative Sicca Syndrom weiter reduziert werden. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf weitere Entwicklungen mit diesem neuartigen Material.
In den vergangenen Editorials berichteten wir unter anderem über den positiven Einfluss von Licht auf die körperliche Aktivität von Sehbehinderten Menschen. Wir wissen aber auch, dass intraoperativ das Mikroskoplicht negative Einflüsse haben kann und unter anderem ein postoperatives Makulaödem fördert. Rosenberg et al. aus New York (USA) verglichen daher in einer prospektiven Studie Kataraktpatienten, die entweder mit einem herkömmlichen Mikroskop oder mit einem modernen 3‑D-Digitalsystem, welches an dasselbe Mikroskop angeschlossen war, operiert wurden. Die Patienten wurden dabei in eine der beiden Gruppen randomisiert und u. a. die verwendete Lichtintensität, die Belichtungszeit, die kumulative Verlustenergie (CDE) festgehalten. Zusätzlich dokumentierte man intraoperative und/oder postoperative Komplikationen sowie präoperative und postoperative Sehschärfe. Die Makuladicke und ein zystoides Ödem wurden mittels optischer Kohärenztomographie analysiert. Die Operationen führte ein einzelner erfahrener Chirurg mittels Femtosekundenlaser durch. Die Studie umfasste 118 Augen in der traditionellen Gruppe und 96 Augen in der digitalen Gruppe. Interessanterweise waren die meisten Parameter in den beiden Gruppen vergleichbar. In der 3‑D-Gruppe erwies sich jedoch die verwendete Lichtintensität als signifikant geringer (19,5%±0,5%) als in der traditionellen Gruppe (48,6%±0,6%; p<0,001). Darüber hinaus erreichte die digitale Gruppe eine bessere Sehschärfe am ersten postoperativen Tag (0,60±0,03) mit niedrigeren CME-Raten (2,1%) im Vergleich zu der traditionellen Gruppe (0,51±0,03; p=0,03; bzw. 9,2%; p=0,03). Die visuelle Erholung und die CME-Raten waren bei Patienten, die sich einer Kataraktoperation mithilfe der 3‑D-Digitalvisualisierungsplattform unterzogen, also signifikant besser, ohne dass es zu erhöhten Komplikationen oder einer längeren Operationszeit kam.
Solche Daten erhöhen möglicherweise die Bereitschaft zur Investition in neue, kostenintensive Geräte, da die Ergebnisse den klinischen Nutzen der neuen Technologien greifbar machen und den wirklichen Nutzen für unsere Patienten darlegen. Jeder Patient weniger ohne ein postoperatives Makulaödem ist ein Erfolg und verbessert die Patientenzufriedenheit und auch die Reputation des behandelnden Arztes. Beides sind Faktoren welche sicherlich als äußerst positiv zu bewerten sind.
Vom Gebiet der Linsenchirurgie, die ja zumeist ältere Menschen betrifft, wollen wir uns jetzt einer Publikation von Zhu et al. zuwenden. Diese beschäftigt sich mit einer vergleichenden Analyse zur Therapie der Amblyopie. Immer noch stellt diese Form der Sehschwäche oftmals die Eltern und die behandelnden Ärzte vor eine große Herausforderung. Mögliche Therapieerfolge werden oftmals durch eine fehlende Compliance der jungen Patienten zunichte gemacht und führen zu großer Frustration. Daher sind gerade neue Therapieansätze, welche die Mitarbeit der Kinder verbessern, von großer Bedeutung.
In der prospektiven Studie sollte die Wirksamkeit einer kombinierten Verwendung von stereoskopischen 3‑D-Videofilmen und Teilzeit-Okklusion bei der Behandlung älterer amblyopie Kinder mit einer reinen Okklusionsbehandlung verglichen werden.Eingeschlossen wurden Kinder mit schlechtem Ansprechen oder schlechter Compliance auf die herkömmliche Okklusionsbehandlung. Es wurden dafür 32 Kinder im Alter von 5–12 Jahren mit Amblyopie in Verbindung mit Anisometropie, Strabismus oder beidem rekrutiert. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip der kombinierten Gruppe und der Okklusions-Gruppe zugewiesen. Bei der kombinierten Behandlung wurde ein binokularer Ansatz verfolgt. Zunächst wurde mittels Bangerter-Filters eine Unschärfe des nichtamblyopen Auges erzeugt und anschließend binokular ein 3‑D-Nahaufnahmefilm angesehen. Das primäre Ergebnis war eine Verbesserung der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA) des amblyopen Auges nach 6 Wochen sowie unter anderem als sekundärer Endpunkt die Verbesserung des Stereosehens nach 3 Wochen.
Bei den 32 Teilnehmern betrug das Durchschnittsalter 6,6 Jahre. Nach 6 Wochen verbesserte sich die mittlere Sehschärfe der amblyope Augen-VA um 0,17±0,08 logMAR und 0,05±0,04 logMAR in der kombinierten bzw. der reinen Okklusions-Gruppe. Der Unterschied war statistisch signifikant. Am Studienende wies nur die kombinierte Behandlung eine signifikant verbesserte Stereoschärfe auf, wie z. B. den binokularen Funktionsscore, und der mittlere Stereoschärfegewinn betrug 0,47 log arcsec (±0,22). Die Forscher schlussfolgerten, dass unter Studienbedingungen die binokulare Behandlungsstrategie zu einem hohen Maß an Compliance führte, was bei älteren, amblyoperen Kindern, die schlecht auf herkömmliche Okklusions-Behandlungen ansprachen, bereits nach kurzer Behandlungsdauer zu einer erheblichen Verbesserung der Sehfunktion führte und zu einer verbesserten Stereosehschärfe. Beide Optimierungen werden natürlich einen positiven Einfluss auf die Seh- und Lebensqualität der jungen Patienten haben. Es bleibt zu hoffen, dass solche Systeme kostengünstig im klinischen Alltag auch in der häuslichen Umgebung fernab von den Studienbedingungen Anwendung finden werden.
Nach diesen 3 aufwendigen Studien komme ich zum Abschluss des Editorials zu einer interessanten Fallzusammenstellung. Bei seltenen Krankheitsbildern sind große, prospektive Studien oftmals schwer durchführbar weshalb Kasuistiken nicht minder interessant sein können. Im Rahmen eines akuten Keratokonus oder einer iatrogenen Keratektasie kann es zu einem Einriss der Descemet-Membran mit schwerwiegenden Folgen kommen. Das oftmals schmerzhafte, akute Krankheitsbild ist mit einem Hornhautödem und Sehminderung verbunden, und nicht selten bleibt das betroffene Areal der Hornhaut lange ödematös. Das Ödem verschwindet normalerweise jedoch nach mehreren Monaten, wenn Endothelzellen einwandern, um das Stroma über der DM-Ablösung abzudecken und eine Basalmembran zu regenerieren. Ein anhaltendes Ödem kann visuell aber signifikante Folgen wie Narbenbildungen mit Neovaskularisation verursachen.
Anhand von 3 Fällen beschreiben Kanu et al. erstmalig ihre neue Technik zur Behandlung dieses Krankheitsbildes. Dabei wird die Descemet-Membran (DM) mit Schnitten entspannt und anschließend eine Luftdescemetopexie durchgeführt. Es wurden 3 Fälle vorgestellt, welche bei einer konservativen Therapie und nach Luftinjektion in die Vorderkammmer keinen Therapieerfolg gezeigt hatten. Um die Wiederlagerung der DM zu erleichtern, führte man eine intraoperative OCT-gesteuerte Descemetotomie mit gebogenen chirurgischen Scheren und einer gebogenen 30-Gauge-Nadel durch und injizierte anschließend Luft. In allen 3 Fällen war die Anlage erfolgreich und das Hornhautödem besserte sich postoperativ relativ schnell. Die Autoren schlussfolgerten, dass dieses Verfahren bei allen therapierefraktären Fällen nach einer alleinigen Luftinjektion als vielversprechend anzusehen sei. Da der operative Aufwand gering ist, kann man möglicherweise ja auch darüber nachdenken, dieses Verfahren direkt als First-line-Therapie einzusetzen.
Die Zukunft wird bei allen hier beschriebenen neuartigen Entwicklungen zeigen, ob sie sich im klinischen Alltag bewähren werden. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch und wünsche Ihnen allen eine genussvolle Lektüre von Kompakt Ophthalmologie und einen schönen Sommer.
Ihr Detlef Holland