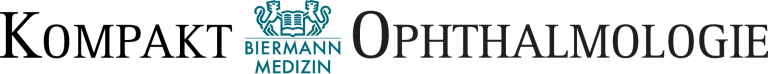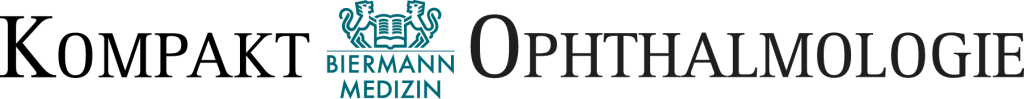Liebe Leserinnen und Leser von Kompakt Ophthalmologie,
das neue Jahr ist bereits in vollem Gange, und wir starten alle mit viel Motivation in den neuen Abschnitt unseres Lebens und unserer beruflichen Tätigkeit. Genauso halten wir es mit Kompakt Ophthalmologie. Die Zahl der Leserinnen und Leser wächst ständig und ist uns Motivation, spannende Zusammenfassungen aus der aktuellen Literatur für Sie bereitzustellen. Schaut man in Pubmed auf die Timeline bzgl. der Anzahl der Veröffentlichungen, so sieht man, dass auch auf unserem Fachgebiet die Anzahl der Publikationen in den vergangenen Jahrzehnten praktisch exponenziell wächst. Dabei zeigt sich, dass der Inhalt häufig immer mehr in die Details z.B. von pathophysiologischen Veränderungen einsteigt. Die Zeiten der Naturwissenschaft, in denen man wie Newton unter einem Baum liegend durch einen fallenden Apfel auf die bahnbrechende Erfindung des Gravitationsgesetz stoßen kann, sind lange vorbei. Das Bild vom großen Ganzen setzt sich aus immer kleiner werdenden Bausteinen zusammen. Mit einer dazu passenden neuen Arbeit über die Biomechanik möchte ich den Fokus zu Beginn dieses Editorials auf die Hornhaut legen.
Die Hornhaut ist als erste physikalisch-optische Grenzfläche von großer Bedeutung für das Sehen und die optische Qualität des Seheindrucks. Dazu ist neben der Aufrechterhaltung der Klarheit auch die Fähigkeit des Gewebes entscheidend, durch die ausreichende Steifheit äußeren Einflüssen wie dem gelegentlichen Reiben, aber insbesondere dem intraokulären Druck standhalten. Die Histologische Struktur und insbesondere die Kollagenfibrillen spielen hierfür eine besondere Rolle. Pathologische Veränderungen entstehen aber schon auf der Zell-Ebene und setzen sich über das Gewebe auf das Gesamtorgan fort. Für uns ist im klinischen Alltag der Keratokonus eines der am häufigsten vorkommenden Krankheitsbilder, und gerade hier ist die Früherkennung von eminenter Bedeutung. Die Prävalenz ist mit ca. 20 auf 1000 Menschen relativ hoch. Auf eine kürzlich erschienene gute Zusammenfassung über dieses Krankheitsbild sei daher hier kurz verwiesen.
Li et al. berichten in einer gerade erschienen Publikation über den Einsatz des Corvis für die Früherkennung des Keratokonus. Wie das ORA (Ocular Response Analyzer) basiert das Corvis auf einem Luft-Tonometer womit in vivo die Biomechanik der Hornhaut genauer untersucht wird.
Da die biomechanischen Veränderungen bereits vor der topographischen und klinischen Manifestation in Erscheinung tritt, gewinnt deren Untersuchung immer mehr an Bedeutung. Daher haben sich hierfür verschiedene Technologien entwickelt. Dazu gehören die Oberflächen-Elastometrie, die Ultraschall-Spektroskopie, die Brillouin-Mikroskopie, die Optische Kohärenz-Elastographie sowie die bereits erwähnte Luftstoß-basierte Optische Kohärenz-Tomographie. Das Corvis-Instrument zeichnet eine Sequenz von dynamischen Bildern in der horizontalen Cross-Sektion mittels einer Scheimpflug-Kamera auf, welche durch einen Luftstoß induziert wird. Die entsprechende dynamische Antwort wird durch verschiedene Parameter (Dynamic Corneal Response [DCR]) festgehalten. Natürlich sind viele der Ergebnisse noch nicht vollständig verstanden, und auch die Qualitäten der Untersuchung bzgl. Bildauflösung etc. sind noch optimierbar. Dennoch zeigen die Ergebnisse im Vergleich zu gesunden Hornhäuten signifikante Unterschiede. Wang und Kollegen analysierten die Verlagerung der Hornhaut, die Spannung und die Geschwindigkeit der Verlagerung mithilfe der digitalen Bildkorrelation. Dabei wurden Probanden einer Normpopulation mit einer Keratokonusgruppe verglichen. Keratokonushornhäute absorbierten mehr Energie bei einer geringeren Steifigkeit und einer größeren Verlagerung nach posterior, wobei auch die dabei auftretende Geschwindigkeit höher war als in der Vergleichsgruppe. Auch die Shear Strain Rate (Scherdehnungsrate) zeigte sich erhöht. Durch diese Analyse konnten erstmalig Karten der Hornhaut bzgl. eben dieser wichtigen Parameter erstellt werden und zum weiteren Verständnis der Erkrankung beitragen. Interessant ist diese Technologie aber nicht nur für die Früherkennung, sondern auch für die postoperative Kontrolle nach Crosslinking. Vieles, was uns schon eigentlich als vollkommen selbstverständlich erscheint, wird durch die neuen Technologien immer weiter vertieft und zeigt uns auch, dass wir noch lange nicht alles verstanden haben und immer weiter in Diagnostik und Therapie optimieren können.
Dieses Phänomen zeigt sich auch im Rahmen der Biometrie. Hier haben wir mit den unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem IOL Master oder dem Lenstar schon wirklich einen sehr hohen Standard erreicht, streben aber immer weiter nach noch höherer Perfektion. Mechleb et al.haben diesbezüglich gerade eine spannende Arbeit publiziert. Zum ersten Mal wurde die effektive Linsenposition des zuerst operierten Auges verwendet, um das refraktive Ergebnis des 2. Auges zu optimieren. In der retrospektiven Studie wurde die „back calculated lens position“ für die Linsenkalkulation des 2. Auges mit einem vorgegebenen Korrekturfaktor für Linsenkakulationsformeln für dicke und dünne Linsen verglichen. 878 Augen von 439 Patienten nach Implantation der gleichen Kunstlinse wurden eingeschlossen. Die Daten wurden genutzt um Haigis-Lens-Position and PEARL-Lens-Position-Formeln zu kreieren, wobei die die Linsenposition des kontralateralen Auges als ein effektiver Vorsagewert für die Linsenposition herangezogen wurde. Außerdem wurden Haigis-CF‑, Barrett-CF- und PEARL-CF-Formeln designt durch Heranziehen des Vorhersagefehlers des 1. Auges. Standardformeln wurden zusätzlich an 1500 Augen, welche am selben Center operiert wurden, mit den optimierten Formeln verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die optimierten Formeln, welche die effektive Linsenposition des 1. Auges bzw. den Vorhersagefehler nutzten, signifikant bessere refraktive Ergebnisse zeigten. Auch wenn diese Verbesserungen sich z.B. absolut nur im Bereich von 0,04 Dioptrien für die PEARL- und die PEARL-CF Formel liegen, so war der prozentuale Korrekturfaktor für alle Formeln immerhin 60% des Vorhersagefehlers des zuerst operierten Auges, was eine deutliche Optimierung darstellt. Eine Einschränkung dieser Ergebnisse habe sich natürlich bei Augen gezeigt, welche schon im Vorfeld erhebliche Unterschiede in den biometrischen Parametern aufwiesen, so die Autoren.
Im Bereich der Therapie der exsudativen AMD liegt heute der Schwerpunkt auf der Gabe von intravitralen VEGF- Inhibitoren. Diesbezüglich finden Sie aktuell in Kompakt Ophthalmologie eine sehr spannende Arbeit, die Hinweise auf die Ursache eines fehlenden Ansprechens und Tachyphylaxie gibt. Gyenes et al. konnten in einer aktuellen Studie zeigen, dass Patienten mit einer neovaskulären AMD signifikant erhöhte Werte von unspezifischen Antikörpern im Kammerwasser aufweisen. Ein Grund dafür ist u.a. die gestörte Kammerwasserschranke, ein anderer veränderte immunologische intraokulare Signalwege. Diese Antikörper können als Ursache für ein schlechtes Ansprechen bzw. für eine Tachyphylaxie sein. Die erhöhten Antikörperwerte wurden in der Studie im Kammerwasser von Patienten unter VEGF-Therapie im Rahmen einer anstehenden Kataraktoperation im Vergleich zu einer nichterkrankten Kontrollgruppe nachgewiesen.
Ich hoffe, diese Hinweise auf drei Arbeiten über die Cornea, Biometrie und die Retina haben sie neugierig auf eine weitere Lektüre in Kompakt Ophthalmologie gemacht. Bleiben wir auch in Zukunft weiter gemeinsam am Ball. In Bildung und Wissenschaft liegt die Zukunft!
Beste Grüße
Ihr Detlef Holland