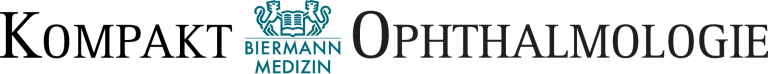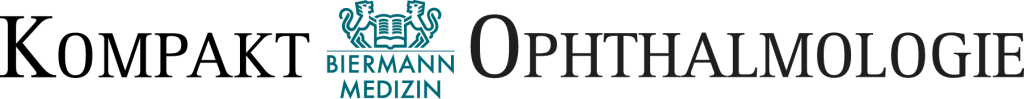Liebe Leserinnen und Leser von Kompakt Ophthalmologie,
der Frühling ist in vollem Gang und die Oberfläche der Welt verändert sich vor unseren Augen in schnellem Tempo. Die Natur erwacht, es wird grün und die Frühlingsblumen erfreuen uns nach dem langen, grauen Winter. Wir merken wie wichtig und positiv diese Eindrücke für uns und unser Wohlbefinden sind. Neue Kraft und Motivation erwacht. Genauso wichtig wie diese Veränderungen der Welt für uns ist die Oberfläche des Auges von entscheidender Bedeutung für die Funktion und die Empfindung. Daher möchten wir uns in diesem Editorial einmal neuen Publikationen über die Konjunktiva widmen, welche als oberflächlichste anatomische Struktur des Auges doch häufig nicht mit der Aufmerksamkeit betrachtet wird, die ihr eigentlich zustehen sollte. Wir wollen die Oberfläche also mit mehr als der Oberflächlichkeit betrachten, welche sich heute in so vielen Gebieten unseres Alltags immer weiter ausbreitet.
Jeder Mensch, der täglich mit Symptomen des trockenen Auges belastet ist, weiß wie sehr dies die Seh- und Lebensqualität einschränken kann. Singh et al. aus Erlangen beschäftigen sich in einer kürzlich in „Ocular Surface“ erschienen Publikation mit der Bedeutung des Harnstoffes im Tränenfilm (Synthesis, secretion and its role in tear film homeostasis. Ocul Surf 2023;27:41–47). Harnstoff – Urea –, welcher nicht mit Harnsäure verwechselt werden sollte, ist das Diamid der Kohlensäure. Als organische Verbindung spielt er eine wichtige Rolle in vielen biologischen Prozessen, wie z.B. dem Stoffwechsel von Proteinen. Bei Säugetieren wird er bekanntermaßen über den Urin und auch in geringem Umfang über den Schweiß ausgeschieden. Harnstoff wurde u.a. auch im Kammerwasser und im Glaskörper entdeckt. Hierbei scheint es sich aber um ein Filtrat aus den Blutgefäßen zu handeln. Auch in der Tränenflüssigkeit wird Harnstoff gefunden und hat hier eine Bedeutung für die Homöostase. Der Nachweis von Transportern und Harnstoff synthetisierenden Enzymen in der Tränendrüse, den Meibomdrüsen, der Bindehaut und der Hornhaut lassen auf eine direkte Harnstoffproduktion für den Tränenfilm schließen. Die Transporter sind UT‑A und UT‑B sowie das Enzym Arginase I und II bzw. die Agmatinase, die auf der Oberfläche des Auges lokalisiert sind. Der Harnstoffspiegel im Tränenfilm wird aber auch durch den Blut-Harnstoffspiegel bestimmt, und es gibt eine direkte Korrelation zwischen ihren Spiegeln. Harnstoff schützt die Augenoberfläche vor osmotischem Stress und scheint zusätzlich eine Rolle für die Stabilität des Tränenfilms zu spielen. Beim evoporativen Sicca-Syndrom finden sich reduzierte Harnstoffwerte im Tränenfilm. Wir sehen hier am Beispiel des Harnstoffes, wie komplex das Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme auch im Bereich der Augenoberfläche ist.
Auch auf dem Gebiet der Blutzirkulation der Bindehaut lassen sich interessante Rückschlüsse auf die Durchblutung unseres Gesamtorganismus ziehen. Asiedu et al. aus Sydney (Australien) befassen sich in einem interessanten Review mit der Mikrozirkulation der Konjunktiva und deren Korrelation zu unterschiedlichen okulären und systemischen Krankheitsbildern (Clin Exp Optom 2023:1–9). Für die Untersuchung der Mikrozirkulation stehen heute unterschiedliche Systeme zur Verfügung. Neben der Spaltlampen-Biomikroskopie existieren mit der Laser-Doppler-Flowmetrie, der OCT-Angiographie, der polarisierenden Spektral-Bildgebung, der Computer-assistierten Intravitral-Mikroskopie und der konfokalen Mikroskopie unterschiedliche Möglichkeiten zur Analyse. Zahlreiche Studien konnten Zusammenhänge zwischen der konjunktivalen Mikrozirkulation u.a. mit dem trockenen Auge, Alzheimer, Diabetes und Hypertension sowie Koronarer Herzkrankheit herstellen. Die Oberfläche des Auges ermöglicht uns also Einblicke in die Beurteilung unterschiedlicher, relevanter Krankheitsbilder.
Bei der Recherche bzgl. aktueller Publikation zur Bindehaut findet sich auch eine Arbeit aus China, welche mit unserem Weltbild nicht mehr einfach zu vereinbaren ist. Li ZZ et al. haben ein Tiermodell für das trockene Auge am Beagle entwickelt. In unserem modernen, europäischen Mainstream-Bewusstsein werden Tierversuche sicherlich immer mehr ausgeklammert. In Deutschland wurden aber in 2021 mehr als 2,5 Mio. Tiere bei Versuchen eingesetzt. Den meisten Menschen sind solche Zahlen wohl eher nicht vorstellbar. Auch in diesem Kontext ist der Blick in die Tiefe unter die Oberfläche wichtig, um sich ein umfassendes Bild der Situation der Forschung zu verschaffen.
Die Kollegen aus China haben ein Tiermodell entwickelt, welches ein stabiles, längerfristiges System etabliert, um das Sicca-Syndrom zu untersuchen. Dafür wurde an Hunden durch einseitige Entfernung der Tränendrüse und des 3. Lids ein trockenes Auge erzeugt. Man führte Schirmer-Test, Untersuchung der Tränenfilmaufrisszeit und Fluorescein-Anfärbbarkeit durch. Als Laborparameter wurden Interleukin und Tumor-Nekrose-Faktor im Tränenfilm und der Konjunktiva ermittelt. Nach 6 Monaten nahm man außerdem histologische Untersuchungen der Bindehaut und der Hornhaut vor. Die Zeichen des trockenen Auges im Bereich der oberflächlichen Untersuchungen sowie die relevanten Laborparameter blieben in diesem Tiermodell über 6 Monate stabil. Die histologischen Untersuchungen zeigten u.a. Neovaskularisationen der Hornhaut, ein verdicktes Stroma und desorganisierte Kollagenfasern. Im Bereich der Bindehaut wurden desorganisierte Becherzellen als Zeichen des trockenen Auges beobachtet. Für das immer weiter zunehmende Krankheitsbild des Sicca-Syndroms kann ein solches Tiermodell vorhersagbare Konditionen für wegweisende Studien ermöglichen.
In unserem klinischen Alltag spielen Entzündungen der Bindehaut eine wichtige Rolle. Für eine optimale Therapie ist dabei die Erkenntnis über potenzielle Erreger von entscheidender Bedeutung. In den meisten Fällen wird die Therapie jedoch ohne Erregernachweis eingeleitet. Umso wichtiger erscheint es, über die Vielfalt der möglichen Bakterien auf der Augenoberfläche und die möglichen Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungsmethoden informiert zu sein. Chen et al. publizierten dazu kürzlich eine Arbeit, bei der an 158 Patienten sowohl Test-Streifen als auch Tupfer-Abstriche zur Analyse der Erreger im Tränenfilm benutzt wurden.
Die Gruppe wurde in Diabetiker und Nichtdiabetiker unterteilt. Interessanterweise zeigt sich in der diabetischen Gruppe zwischen den Ergebnissen des Test-Streifens und dem Tupferabstrich keine signifikanten Unterschiede, wohingegen sich in der Gruppe ohne Diabetes signifikante Unterschiede ergaben. Auch zeigten sich zwischen den beiden Gruppen beim Einsatz von Test-Streifen signifikante Unterschiede im Ergebnis, jedoch nicht für die Resultate bei der Tupfer-Methode. Die Studie ergab in der Zusammenfassung, dass unterschiedliche Methoden in den beiden Gruppen zu signifikanten Unterschieden bezüglich der mikrobiellen Ergebnisse führen können. Somit zeigt sich, dass es im Zweifelsfall notwendig sein kann, unterschiedliche Methoden für den Erregernachweis anzuwenden.
In diesem kleinen Ausflug in neuere Forschungsergebnisse im Bereich der Bindehaut zeigt es sich wieder einmal mehr, wie die Forschung auf unserem Fachgebiet immer vielschichtiger wird. An uns ist es daher, uns immer weiter fortzubilden und nicht nur die Oberfläche unserer wunderbaren Augenheilkunde im Blick zu haben.
Ich wünsche Ihnen allen ein wunderbares Osterfest und einen sonnigen Frühling.
Ihr Detlef Holland