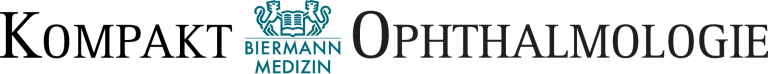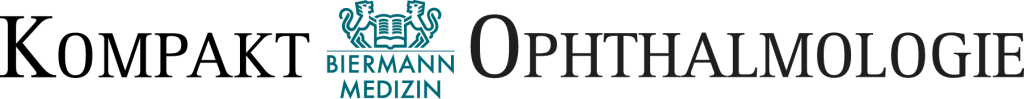„Here comes the SUN” …

Gerne stimmen wir Sie auf eine erholsame Sommerzeit ein. Aber Sie erinnern sich sicherlich: SUN steht für „Standardization of Uveitis Nomenclature Working Group“. Diese Gruppe von Kollegen hatte zuletzt 2005 die internationale akzeptierte Einteilung der intraokularen Entzündung strikt und einfach nach anatomischen Kriterien (anterior, intermediär, posterior) eingeführt und damit einen weltweiten Standard gesetzt.
Nach längerer Pause folgt nun ein Paukenschlag. Nicht weniger als 17 der häufigsten Uveitisformen werden herausgegriffen und über einen Algorithmus in eine Klassifikation überführt. Für jedes einzelne Krankheitsbild wurden zunächst Leitbefunde von einem Expertenkreis festgelegt, in einem Datenpool von mehreren 100 Uveitispatienten auf ihre Validität geprüft und schlussendlich einer AI-Auswertung unterworfen. Es resultiert ein Katalog von 3–5 Leitbefunden, der die einzelnen Krankheitsbilder definiert. Da neben morphologischen Befunden auch Laborergebnisse eingehen, wird damit auch eine zielgerichtete Diagnostik gefördert. In einer lesenswerten Serie von Publikationen im „American Journal of Ophthalmology“ (April-Juni) werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe vorgestellt. In der Auswahl der Uveitisformen finden sich nahezu alle klinischen Entitäten. Einige davon, die häufig und für Sie relevant sind, seien an dieser Stelle herausgegriffen.
Die Fuchs-Uveitis betrifft etwa 2–3% aller intraokularen Entzündungen und wird seit der Erstbeschreibung durch Ernst Fuchs (1906) als „Syndrom“ verstanden – ein Terminus, der auch in der aktuellen SUN-Klassifikation so beibehalten wird. E. Fuchs hatte damals sein Augenmerk auf die Heterochromie gerichtet und alle weiteren klinischen Beobachtungen dem nachgeordnet. In der aktuellen SUN Klassifikation wird die Heterochromie zwar noch berücksichtigt, aber den wesentlich häufigeren Befunden, wie unilateralem Auftreten, wenig ausgeprägtem Reizzustand, begleitender Glaskörperentzündung etc. untergeordnet. Diese Beschreibung reicht sicherlich aus, um dieses Krankheitsbild von anderen Formen der „Iridozyklitis“ zu differenzieren. Etwas verwundert es allerdings, dass dabei weitere Kriterien unerwähnt bleiben.
Es ist gut etabliert, das bei der Fuchs-Uveitis bereits frühzeitig intraokular Antikörper gegen Röteln nachgewiesen werden können – ein Befund, der erstmals von C. Quentin aus Göttingen berichtet wurde. Es ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass die Antikörperbestimmung in den USA faktisch unbekannt ist und auch in Europa nicht allerorts verfügbar ist. Früh und sicher die Diagnose zu stellen, ist wichtig und von praktischer Bedeutung. Viele dieser Patienten weisen einen chronischen Verlauf auf und laufen Gefahr, längerfristig mit Steroiden oder gar Immunsuppressiva behandelt zu werden. Diese haben sich hier als ineffektiv und fehl am Platze erwiesen und beeinflussen den Verlauf durch Katarakt und Glaukom eher negativ.
Gerade den viralen Infektionen als Ätiologie der anterioren Uveitis wurde in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem bei streng unilateralem, rezidivierendem Auftreten wird rasch der Verdacht auf Viren der Herpesfamilie gelenkt. Da intraokulare HSV- und VZV-Infektionen gezielt antiviral behandelt werden können, profitieren diese Patienten von einer frühzeitigen adäquaten Diagnostik. Auch hier hat die SUN Arbeitsgruppe einen Kriterienkatalog aufgestellt. Klinische Leitbefunde stehen wieder im Mittelpunkt. Ein sorgfältiger Blick z.B. auf Irisveränderungen sowie der Ausschluss einer Beteiligung des hinteren Augenabschnittes werden als Leitkriterien definiert. Als eine weitere diagnostische Säule wird der intraokulare Nachweis von HSV- oder VZV-DNA mittels PCR eingebracht.
Zusammenfassend ist anzuerkennen, dass die SUN-Arbeitsgruppe lesens- und wissenswerte Definitionen für viele Krankheitsbilder vorgegeben hat. Es ist ihr gelungen, klinische Kriterien herauszustellen, die eine praxisrelevante Unterscheidung der Entzündungsformen erlauben. Bei vielen Krankheitsbildern wird gleichzeitig die Ätiopathogenese hervorgehoben und damit auch eine zielgerichtete (Labor-)Diagnostik gefördert.
Wir bleiben bei intraokulären Entzündungen. Bei allen Uveitisformen ist das zystoide Makulaödem eine wesentliche, prognosebestimmende Komplikation. Durch die Optische Kohärenztomographie (OCT) haben sich Diagnostik und Verlaufsbeurteilung des Makulaödems deutlich vereinfacht. Längst werden morphologische Veränderungen im OCT als Biomarker herangezogen. Dies hat sich, beispielsweise beim diabetischen Makulaödem, gut etabliert. So sind die Ergebnisse von Liu und Mitarbeitern nicht ganz überraschend. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis das DRILs als Marker für den Verlauf und die funktionelle Prognose des Ödems herangezogen werden können.
Werfen wir abschließend noch den Blick auf unsere jüngsten (Uveitis-)Patienten. Der Zusammenhang zwischen entzündlichen Nierenerkrankungen und intraokularer Entzündung wird in der aktuellen Arbeit von Rytkönen et al. behandelt. In einer der bisher größten Kohorten von Patienten mit TINU (Tubulointerstitielle Nephritis mit Uveitis) wurden die Langzeitergebnisse beurteilt und vor allem die Auswirkungen bezüglich der Nierenbeteiligung betrachtet. Erfreulicherweise können die Autoren darüber berichten, dass sich die Nierenfunktion bei ca. 80% der Kinder wieder normalisierte. Allerdings waren längerfristige systemische Behandlungen und sorgfältige Beobachtung der Kinder notwendig. Rezidive der Nephritis nach Absetzen systemischer Steroide, renovaskuläre Hypertonie, die bis hin zum Nierenversagen und zur Transplantation führten, zeigen jedoch die weitreichenden Konsequenzen für diese Kinder. Übrigens: Auch dieses Krankheitsbild wurde in der SUN Arbeitsgruppe aktuell charakterisiert und definiert.
„Here comes the sun“ – dieser Song entstand 1969, in einer für die Beatles damals schwierigen Zeit. Am Ende wurde er doch zum erfolgreichen „Hit“ und hat Jahrzehnte überdauert – dies kann auch für die neuen SUN Klassifikationen erwartet werden.
Bleibt mir nur zu wünschen, dass auch Sie auf der Sonnenseite bleiben.
In diesem Sinne wünschen ein angenehmes Lesevergnügen
Uwe Pleyer und das Team von Kompakt Ophthalmologie