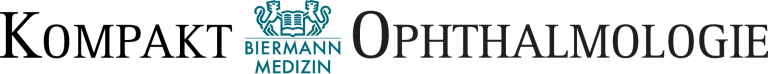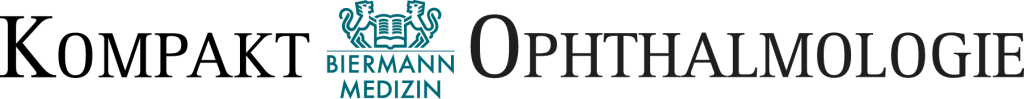Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Makulaödem (ME) bleibt eine der häufigsten Ursachen für Sehverschlechterung bei retinalen Erkrankungen wie diabetischer Retinopathie (DR), Uveitis oder retinalem Venenverschluss. Grund genug, um einen Blick auf aktuelle Arbeiten zu potenziellen Risiken, molekularbiologischen Biomarkern, KI-gestützter Diagnostik und klinisch relevanten Therapieansätzen zu werfen.
Sie generieren Milliarden Umsätze und waren 2024 die umsatzstärkste Medikation in Deutschland: die Rede ist von GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP‑1 RAs). Ursprünglich wurden sie zur Behandlung des Typ-2-Diabetes entwickelt, haben sich aber darüber hinaus – vor allem auch als Wirkstoff zur Gewichtsreduktion – Aufmerksamkeit verschafft. Sie senken den Blutzuckerspiegel, indem sie die Insulinsekretion erhöhen und die Glukagonsekretion verringern. Obwohl sie viele Vorteile bieten, gibt es Risiken und Nebenwirkungen. Bereits kurz nach Einführung von Semaglutid als erstem GLP-1-RA im Jahr 2016 wurde der Verdacht auf unerwünschte Effekte bei vorbestehender diabetischer Retinopathie (PDR) oder ME geäußert. Dies schien zunächst paradox, da GLP-1-Rezeptoren in den Ganglienzellen der Retina und dem zentralen Nervensystem vorliegen und daher ein eher neuroprotektiver Effekt zu erwarten wäre. Andererseits wurde vermutet, dass die schnelle Blutzuckerkontrolle und der rasche Gewichtsverlust die bereits gestörte Gefäßpermeabilität weiter verstärken könnten. Seitdem erschienen mehrere Studien mit kontrovers bewertetem Ausgang. Daher wundert es nicht, dass sich gleich mehrere groß angelegte Analysen diesem Thema widmen. Barkmeier et al. stellen eine vergleichende Studie mit mehr als 90.000 erfassten Personen vor, die unterschiedliche GLP-1-RAs (Semaglutid, Dulaglutid, Liraglutid, Exenatid) erfasste. Als Endpunkte wurde ein behandlungsbedürftiges ME und/oder eine PDR gewählt. Die Autoren konnten zwar Unterschiede zwischen den genannten Substanzen feststellen, allerdings wurde kein allgemein erhöhtes Risiko belegt. Ein ähnliches Resümee ziehen Ramsey et al. aktuell in „JAMA Network Open“. Auch hier wurde der Frage nach Risiken für ein diabetisches ME durch GLP-1-RAs nachgegangen. Die Forschenden erweiterten den Fokus allerdings noch in Hinblick auf das Auftreten einer anterioren ischämischen Optikusneuropathie (AION). In kleinen Fallserien war zuvor auf einen möglichen Zusammenhang hingewiesen worden. Die Auswertung von mehr als 180.000 Datensätzen konnte nun sowohl bezüglich des diabetischen ME als auch der AION kein signifikant erhöhtes Risiko ermitteln. Resümee: Strikte Routinekontrollen scheinen nicht zwingend bei der Behandlung mit GLP-1-RAs angezeigt. Allerdings weisen beide Autoren Teams darauf hin, dass ihre Analysen aufgrund unterschiedlicher Befunderhebung und Suchkriterien limitiert sind. Insbesondere bei bereits bestehender Retinopathie empfehlen sie, die Patienten entsprechend über Risiken zu informieren und ophthalmologische Kontrollen vor allem bei Therapieeinleitung durchzuführen.
Dass Prostaglandin-Analoga, die zur Glaukomtherapie eingesetzt werden, in seltenen Fällen ein ME auslösen können, ist seit Längerem bekannt. Bei klassischen PG-F-Rezeptor-Analoga (Latanoprost, Travoprost oder Bimatoprost) betrifft dies vor allem pseudophake oder aphake Augen, während es bei phaken Augen sehr selten ist. Dies könnte bei Omidenepag Isopropyl (OMDI), einem selektiven EP2‑Rezeptor‑Agonisten, anders sein. Darauf weisen zwei aktuelle Beiträge in „JAMA Ophthalmolog“ hin. Cheng und Mitarbeiter beobachteten bei 8 von 86 phaken Glaukompatienten unter OMDI ein ME. Bei allen Augen war in der Vergangenheit eine Trabekulektomie erfolgt. In einem Kommentar zu dieser Studie wird auf das EP2-Rezeptorprofil eingegangen und vermutet, dass OMDI durch den vorangegangenen Eingriff besser den hinteren Augenabschnitt erreicht. In Japan und einigen asiatischen Ländern, in denen OMDI bereits vor längerer Zeit zugelassen wurde, ist der Wirkstoff bei Pseudophakie/Aphakie kontraindiziert; in den USA wird vor Anwendung bei diesen Risikogruppen gewarnt. Schlussfolgerung: Das absolute Risiko für ein ME ist insgesamt niedrig, kann bei OMDI aber in bestimmten Konstellationen auch bei phaken Patienten relevant sein.
Die hier genannten Studien stellen einmal mehr heraus, wie wichtig die Früherkennung des ME unabhängig von der Genese ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, dass unter bestimmten Umständen auch serologische Marker einen Hinweis bieten können. Dies postulieren Lin et al. in der aktuellen Ausgabe von „Frontiers in Neurology“. Sie untersuchten die Korrelation zwischen Serum-miRNA-Expressionsprofilen und dem Ausmaß des ME bei RVO-Patienten. Die Ergebnisse zeigen, dass bestimmte miRNAs mit dem Schweregrad des Ödems korrelieren. Für uns zunächst naheliegender und praktikabler bleiben sicherlich bildgebende Verfahren – allen voran Merkmale, die im OCT erkennbar sind. Dazu einige interessante neue Erkenntnisse: In der August-Ausgabe von „PLoS One“ konnten Delavari et al. mittels Künstlicher Intelligenz (KI) geschlechtsspezifische Unterschiede bei DR/DME herausstellen. Da Frauen in dieser Untersuchung auch ein signifikant erhöhtes Risiko für ein ME aufwiesen, halten die Autoren dies für die Früherkennung für wichtig. Ob dies zutrifft und zur personalisierten Behandlung beiträgt, bleibt abzuwarten. Diese zurückhaltende Einstellung ist angebracht in Hinblick auf die eher ernüchternde Metaanalyse von Nanji K et al. zu OCT-Biomarkern bei diabetischem ME. Sie fassen die bisherigen Beobachtungen aus 27 Studien zusammen, in denen 75 (!) OCT-Biomarker untersucht wurden. Es konnte kein singuläres Merkmal mit hoher Sicherheit als prädiktiv mit der Prognose oder Veränderung der Sehschärfe herausgestellt werden. Als gerade einmal „mäßig“ wurden die Ausgangsbefunde hyperreflexive retinale oder choroidale Herde, DRILs oder gestörte Ellipsoid Zone für eine negative Prognose bewertet. Kritisch merken die Autoren an, dass eine stärkere Standardisierung und Klassifizierung von OCT-Befunden zu fordern ist, sowie Störvariablen besser kontrolliert werden sollten.
Abschließend noch aktuelles zur Therapie des ME. Der Trend in der Behandlung des ME bei Diabetes ist klar: Die intravitreale anti-VEGF-Gabe ist Goldstandard. Dosis, Dauer und Deeskalation stehen im Mittelpunkt aktueller Entwicklungen. Weniger Aufmerksamkeit erfährt dagegen die Behandlung des ME bei Uveitis. Steroide (peribulbär, intravitreal oder systemisch) bleiben das Rückgrat der Uveitistherapie. Die Vor- und Nachteile sind bekannt. Bisherige Anwendungen von intravitrealen Anti-VEGF-Präparaten führten bisher zu inkonsistenten Ergebnissen. Möglicherweise zu Unrecht, wie Lin et al. zeigen: Ein Sarkoidosepatient mit mehrfach therapierefraktärem zystoiden ME konnte durch Faricimab erfolgreich behandelt werden. Das Patientenbeispiel legt nahe, dass die vaskuläre Stabilisierung über bispezifische Ang 2/VEGF-Hemmung auch bei überwiegend inflammatorischem Ödem wirksam eingreifen kann. Da dies lediglich eine kasuistische Mitteilung betrifft und off-label erfolgte, wird es weiterhin Einzelanwendungen vorbehalten bleiben. Dagegen sind Steroidimplantate weiter im Vormarsch. Eine wichtige Erweiterung im Spektrum der Indikationen beschreiben unsere portugiesischen Kollegen. Sie verwendeten bei postchirurgischem, therapierefraktärem ME das langfristig wirksame Fluocinolonacetonid(FAc)-Implant. Bei allen acht Patienten waren Vorbehandlungen mit topischen Kortikosteroiden, Triamcinolon-Injektion oder Dexamethason-Implantat nicht langfristig wirksam gewesen. Bei nahezu allen Betroffenen konnte der Visus signifikant verbessert und über 36 Monate erhalten werden. Es wurden keine auffälligen Sicherheitsdaten berichtet.
Der „Diabetic Macular Edema Pipeline Outlook Report“ (DelveInsight, August 2025) zeigt, dass derzeit über 45 Unternehmen an mehr als 50 innovativen Produkten arbeiten. Mit dieser vielversprechenden Perspektive verabschieden wir uns in die Spätsommerzeit.
Ihr Uwe Pleyer und das Team von KOMPAKT OPHTHALMOLOGIE