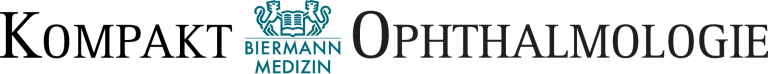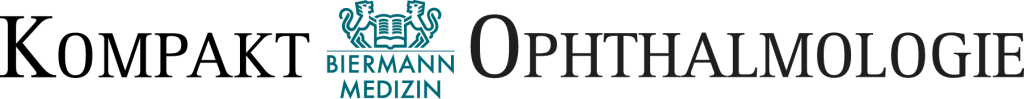Sehr geehrte Leserinnen und Leser von Kompakt Ophthalmologie,
das neue Jahr startet schon wieder mit einem unglaublichen Tempo. Viele gute Vorsätze müssen leider manchmal schnell verworfen werden. So musste ich bedauerlicherweise auch feststellen, dass mein Vorsatz, das Editorial immer frühzeitig zu schreiben, leider direkt zu Jahresbeginn nicht erfüllt wurde. Daher erscheint mein Editorial leider erst zum Valentinstag. Vom richtigen Blickwinkel aus betrachtet, ist dies doch aber eigentlich auch ein schönes Datum.
In den ersten Wochen des Jahres sind schon zahlreiche interessante Publikationen in unserem Fachgebiet publiziert worden. Choksi et al. berichteten im Januar im „Journal of Regulatory Toxicology and Pharmacology“ (2024;146:105543) über eine retrospektive Untersuchung bezüglich der möglichen Augenschädigungen durch chemische Substanzen, welche in der Agrar-Industrie eingesetzt werden.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat Leitlinien für die In-vitro-Testung von Substanzen bezüglich ihrer möglichen Potenz zur Schädigung der Augen erstellt. Für den großen Bereich der agrochemischen Substanzen liegen zur Zeit jedoch wenige Daten vor. Die Autoren haben daher retrospektiv in vivo und in vitro Daten von 192 chemischen Substanzen analysiert. Für mehr als 75 Jahre wurde vorwiegend ein In-vivo-Test an Hasen – der sogenannte Draize Eye Test – für die Testung von Substanzen angewendet.
Da der Test jedoch für Variationen unter den Tieren sowie auch für Beobachtungsfehler anfällig ist, ist die Reproduzierbarkeit des Tests nicht optimal. Auch aus ethischen Gründen ist es daher sinnvoll, andere Systeme zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte United Nations Globally Harmoized System for Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Dabei wird die Konzentrationsschwelle von Einzelsubstanzen als Richtlinie für potenzielle Schädigungen von Haut und Auge herangezogen, um daraus die mögliche Schädlichkeit von Substanzmischungen ohne Tierversuch zu evaluieren.
Zahlreiche In-vitro-Testmethoden für die Irritation des Auges durch Substanzen wurden bisher validiert. Einzelne dieser Tests wurden, wie bereits erwähnt, von der OECD als Guidelines adaptiert, wodurch auch der Datenaustausch zwischen Ländern erleichtert wird und damit unnötige Doppeltestungen vermieden werden können.
Die Autoren konnten nun für den Agrarbereich durch ihre Datenanalyse folgern, dass die In-vitro-Testungen eine sehr hohe Vorhersagbarkeit für die mögliche Schädigung des Auges durch verschiedene Substanzen und Substanzmischungen zeigen. Tierversuche und intensive Einzeltestungen könnten somit reduziert werden. In der Zukunft wird hier sicherlich auch für weitere Analysen der vorliegenden Datenlage die Künstliche Intelligenz von großer Bedeutung sein.
Einem ganz anderen Themenkreis aus der Neuroophthalmologie widmeten sich Cheng et al. in der Zeitschrift „Attention, Perception & Psychophysics“ (2024;86:579–586). Die Fähigkeit des Menschen, Bewegungen schnell zu erkennen und zu analysieren, ist für das Überleben und die zwischenmenschliche Kommunikation von grundlegender Bedeutung. Interessanterweise wird die Wahrnehmung von Bewegungen jedoch stark beeinträchtigt, wenn diese verkehrtherum dargeboten werden – das Bild also im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Kopf steht. Es wird angenommen, dass dieser bekannte Inversionseffekt durch einen Mechanismus zur Erkennung von Bewegungen verursacht wird, welcher stark auf schwerkraftkompatible Bewegungssignale abgestimmt ist. Hier zeigt sich, wie sehr die menschliche Evolution durch die Schwerkraft auf unserem Planten beeinflusst wurde. In der aktuellen Studie haben die Autoren den sogenannten Inversionseffekt in der Bewegungswahrnehmung mithilfe einer No-Report-Pupillometrie bewertet. Die Autoren fanden dabei heraus, dass die Pupillengröße deutlich vergrößert war, wenn Beobachter aufrechte, schwerkraftkompatible Bewegungsmuster betrachteten, verglichen mit den umgekehrten, schwerkraftinkompatiblen Gegenstücken. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Größe der Pupille die Wahrnehmung von schwerkraftabhängigen Bewegungen signalisieren kann. Noch wichtiger ist nach Auffassung der Autoren, dass die aktuelle Studie mit der Einfachheit der Durchführung, der Objektivität und Nichtinvasivität der Pupillometrie den Weg für weitere potenzielle Anwendungen von Pupillenreaktionen ebnen kann. So könne beispielsweise die Pupillometrie auch bei der Erkennung von Defiziten der Wahrnehmung Bewegungen bei Personen mit sozio-kognitiven Störungen hilfreich sein und somit ein neues Feld der Forschung aufzeigen.
Im wahrsten Sinne weit entfernt von dem sensitiven Gebiet der Neuroopthalmologie bewegen sich Ali et al. mit einer interessanten Übersichtsarbeit in „Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery“ (2024;40(1):30–33), welche sich mit den im wahrsten Sinne des Wortes harten Fakten von Dakryolithen beschäftigt. Der Begriff Dakryolithen bezieht sich auf Konkremente im Tränensystem. Wenn der Begriff „Dakryolith“ nicht spezifiziert ist, bezieht er sich normalerweise auf nichtinfektiöse Formen. Diese werden üblicherweise im Tränensack und im Tränennasengang medizinisch auffällig. Häufiger werden sie aber zufällig während einer Dakryozystorhinostomie diagnostiziert, wobei die Inzidenz bei allen Dakryozystorhinostomie-Operationen bei 5,7% bis zu 18% liegt. Die Dakryolithiasis ist ein komplexer Prozess im Tränensystem, und aktuelle Erkenntnisse deuten auf eine multifaktorielle Ätiologie hin. Falls eine Anfälligkeit vorliegt, kann das auslösende Ereignis eine Verletzung des Tränensack- oder Tränennasengang-Epithels sein, welches zu einem Mikrotrauma mit Blutaustritt führt. Die Blutgerinnsel fungieren als Nidus, also als Kern für die nachfolgende Ablagerung von Mukopeptiden. Lokal vorhandene Zelltrümmer, von der Augenoberfläche gewaschene Zellreste und Fremdstoffe aus der Tränenflüssigkeit lagern sich in der Folge immer weiter an. Dieser Prozess wird durch eine veränderte Rheologie und Zusammensetzung des Tränenfilms unterstützt. Nach der Bildung von Dakryolithen bilden sich auf der Oberfläche sogenannte extrazelluläre Neutrophilenfallen, die dazu beitragen, dass sich die Dakryolithen nicht mehr auflösen. Ein interessanter, multifaktorieller Prozess steht also hinter der Bildung dieses Krankheitsbildes, welches sich zumeist im Tränensack verborgen manifestiert, aber auch im Tränenkanal zu einer an der Spaltlampe sichtbaren Pathologie führen kann.
Das Glaukom als eine potenziell chronisch progressive Augenerkrankung, die durch den fortschreitenden Verlust retinaler Ganglienzellen (RGC) verursacht wird, beschäftigte in einer aktuellen Arbeit die Arbeitsgruppe um Yi (Biochem Biophys Res Commun 2024;694:149414). Derzeit existiert keine klinisch zugelassene Behandlung, welche die Überlebensrate von RGC direkt verbessern kann. Das Apolipoprotein E (APOE)-Gen steht in engem Zusammenhang mit dem genetischen Risiko zahlreicher neurodegenerativer Erkrankungen und ist in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Thema auf dem Gebiet der Krankheitsforschung geworden, wobei die Pathogenese degenerativer Netzhauterkrankungen in engem Zusammenhang mit den Erkrankungen des zentralen Nervensystems steht. APOE besteht aus drei Allelen – ε4, ε3 und ε2 – auf einem einzigen Locus, bei einem unterschiedlichen Risiko für ein Glaukom. APOE4 und die APOE-Gen-Deletion (APOE-/-) können den RGC-Verlust reduzieren. Im Gegensatz dazu führen APOE3 und das allgemeine Vorhandensein von APOE-Genen (APOE+/+) zu einem erheblichen Verlust von RGC-Körpern und Axonen, was das Risiko des Zelltodes von RGC erhöht. Bezüglich des APOE2 gibt es derzeit es noch keine eindeutigen Hinweise, die darauf schließen lassen, ob es für das Glaukom nützlich oder schädlich ist. Die genannte Studie fasst den Mechanismus verschiedener APOE-Gene beim Glaukom zusammen und spekuliert, dass eine gezielte APOE-Intervention eine vielversprechende Methode zum Schutz vor dem Verlust von RGCs beim Glaukom sein könnte. Vermutlich werden wir in der Zukunft diesbezüglich zahlreiche neue therapeutische Ansätze für die Therapie sehen, welche die Tropfenbehandlung und chirurgische Therapie bereichern werden. Bis zum klinischen Einsatz liegt aber sicher noch viel Arbeit vor den Forschern.
Diese vier aktuellen Publikationen auf unserem Fachgebiet zeigen erneut, wie umfangreich die verschiedenen Forschungsfelder bezüglich unserer „kleinen“ Augenheilkunde sind. Für uns Ärzte ist es immer wichtig, hier einen Überblick zu behalten, obwohl es nahezu unmöglich erscheint, in alle Teilgebiete bis ins Detail einzusteigen. Wir hoffen, dass unsere Zusammenfassungen in Kompakt Ophthalmologie dabei eine gute Hilfe sein können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre und weiter einen guten Start in das Jahr 2024.
Ihr Detlef Holland