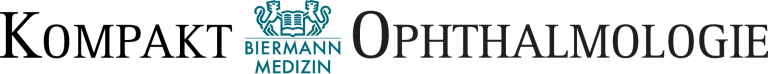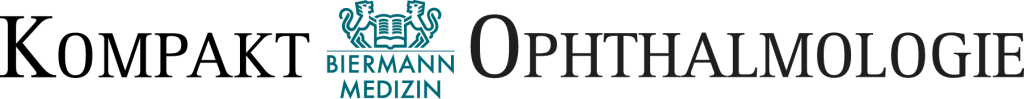Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Diabetes mellitus verändert die Kornea und die okuläre Oberfläche auf vielschichtige Weise — von der sensiblen Innervation bis zur endothelialen Homöostase. Die Diabetische Keratopathie ist keine Randerscheinung, sondern ein relevantes Risiko für neurotrophe Keratopathie und Hornhautulzera. In einer großen, retrospektiven Auswertung von Patientendaten zeigte sich ein signifikant erhöhtes Risiko für Ulzera und neurotrophe Keratopathie bei Diabetes; Alter und männliches Geschlecht wirkten als zusätzliche Risikofaktoren, und Ulzera selbst waren Prädiktoren für das Vorliegen eines Diabetes. Die Folge können infektiöse, schlecht therapierbare Keratitis und Notwendigkeit einer Keratoplastik als Ultima Ratio sein. Grund genug, aktuelle Veröffentlichungen mit differenzierten Antworten auf klinisch relevante Fragen zu Diagnostik, Therapie und Transplantationsplanung vorzustellen.
Antidiabetika als neue Tränenfilmtherapie?
Die Ergebnisse der von Ottonelli et al. vorliegenden Studie werfen genau diese Frage auf. Trockene Augen gehören zu den häufigsten okulären Komplikationen bei Diabetes mellitus Typ 2, bislang jedoch ohne klare therapeutische Anknüpfung an die antidiabetische Medikation. Glucagon-like-Peptid‑1(GLP‑1)-Rezeptoragonisten (GLP‑1 RAs) haben sich in den vergangenen Jahren als multifunktionale Substanzen (Stichwort: „Schlankmacher“) etabliert – mit antiinflammatorischen und gefäßprotektiven Effekten, die weit über die Blutzuckerkontrolle hinausgehen. In einer Fall-Kontroll-Studie zeigten Patienten unter GLP-1-RA-Therapie signifikant bessere Ergebnisse in Schirmer-Test und Tränenfilmaufreißzeit als Patienten mit anderen blutzuckersenkenden Therapien. Besonders bemerkenswert: Auch die Subgruppenanalyse deutet auf differenzielle Effekte zwischen GLP-1-RAs, SGLT2-Inhibitoren und Kombinationstherapien hin. Für die klinische Praxis eröffnet sich damit die interessante Möglichkeit, antidiabetische Therapieentscheidungen auch unter dem Aspekt okulärer Komorbiditäten zu betrachten (siehe auch: September-Editorial KOMPAKT OPHTHALMOLOGIE). Doch zunächst wünsche ich mir prospektive, multizentrische Studien, um diese Hypothese zu bestätigen und die zugrunde liegenden Mechanismen zu klären.
Ebenfalls klein und explorativ ist die Studie von Zhang et al., die Neuropeptide als potenzielle (neue) Biomarker des Trockenen Auges herausstellen. Die Pathophysiologie der Dry Eye Disease (DED) wird zunehmend als komplexes Zusammenspiel von Entzündung, Tränenfilmstörung und neurosensorischer Dysfunktion verstanden. Die vorliegende Studie liefert nun spannende Evidenz dafür, dass auch Neuropeptide im Tränenfilm eine Schlüsselrolle spielen könnten. Bei Patienten mit DED waren die Konzentrationen von Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) und Substanz P (SP) signifikant erniedrigt, während Neuropeptid Y (NPY) unverändert blieb. Bemerkenswert ist die klare Korrelation: Niedrigere CGRP- und SP-Werte gingen mit schlechteren klinischen Parametern einher – höheren OSDI-Scores, stärkerer Hornhautfärbung und reduzierten Tränenfilmstabilitätswerten. Besonders hervorzuheben ist die Assoziation zwischen Schirmer-Test und CGRP-Konzentration, die auf eine direkte Verbindung zwischen Tränenproduktion und Neuropeptid-assoziierter Regulation hindeutet. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Veränderungen der neuropeptidergen Signalwege nicht nur Begleitphänomene, sondern möglicherweise zentrale Treiber der Symptomatik sind. Für die klinische Praxis eröffnet sich damit die Perspektive, Neuropeptide künftig als Biomarker für Krankheitsaktivität und Schweregrad einzusetzen – und langfristig sogar als therapeutische Targets zu betrachten. (?)
Beide Studien verdeutlichen eindrucksvoll, wie sehr sich das Verständnis des Trockenen Auges von einer rein lokalen Erkrankung hin zu einem systemisch und neurosensorisch geprägten Krankheitsbild erweitert. Wir bleiben beim Zusammenhang Diabetes–Kornea und widmen uns jetzt dem Endothel.
Von der Oberfläche zum Endothel – Keratoplastik und Spenderdiabetes: neue Evidenz
Die Frage, ob Spenderdiabetes die Ergebnisse der Hornhauttransplantation (hier: DMEK) beeinträchtigt, wurde im Oktoberheft des „JAMA Ophthalmology“ durch eine randomisierte Studie von Price et al. mit hoher methodischer Qualität adressiert. In einer großen Kohorte von mehr als 1400 Studienaugen zeigten die Autoren sehr hohe Ein‑Jahres‑Erfolgsraten nach DMEK, ohne nachweisbaren Unterschied zwischen Gewebe von Spendern mit und ohne Diabetes. Die Studie dokumentiert einen Ein‑Jahres‑Graft‑Success‑Rate von 96,3 Prozent bei Empfängern von Gewebe ohne Diabetes und 97,1 Prozent bei Empfängern von Gewebe mit Diabetes. Die Differenz war statistisch und klinisch nicht relevant. Begleitend fanden sich keine Unterschiede in der endothelialen Zellzahl, dem prozentualen Zelltod oder morphometrischen Parametern wie Zellgrößenvariation und Hexagonalität ein Jahr nach Eingriff in einer separaten, groß angelegten Auswertung. Zusammengenommen sprechen diese Befunde dafür, dass Diabetes in der Anamnese des Spenders, zumindest unter den in der Studie untersuchten Bedingungen und in Bezug auf Ein‑Jahres‑Endpunkte, kein zusätzliches Risiko darstellt.
Zentrale Erkenntnis: Der diabetische Status der Spenderinnen und Spender beeinträchtigte weder die Ein-Jahres-Transplantatüberlebensrate noch die endotheliale Zellgesundheit. Dies widerspricht älteren Beobachtungen zu erhöhter Präparationsanfälligkeit und potenziell erhöhtem endothelialen Zellverlust und liefert Level-1-Evidenz zur Sicherheit der Verwendung diabetischer Spenderkorneae im ersten Jahr. Trotz der Stärke des Studiendesigns müssen wir die Grenzen beachten. Die Analyse konzentrierte sich auf Ein‑Jahres‑Endpunkte bei primär Niedrig-Risiko-DMEK‑Empfängern (vor allem Fuchs‑Dystrophie). Langzeitdaten, Komorbidität, Subgruppenanalyse und Ergebnisse in Hochrisikofällen sind noch ausstehend. Ebenso ist die Frage offen, ob bestimmte medikamentös schlecht eingestellte Diabetesformen, polyneuropathische Veränderungen oder vaskuläre Komplikationen des Spenders subtile, später eintretende Effekte haben könnten. Längere Follow-up-Daten nach DMEK mit diabetischen Spenderinnen/Spendern, standardisierte Präparationsmethoden und prospektive Oberflächenstudien mit Sensibilitäts- und Nervenbildgebung (IVCM) wären meines Erachtens interessante Aspekte.
Einen Beitrag zum Thema Gewebe-„Qualität“ bieten Amir et al. aus Israel in der aktuellen Ausgabe von „BMJ Open Ophthalmology“ – ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter Artikel. Er liefert nicht nur eine solide Analyse klinischer und epidemiologischer Faktoren, die die Endothelzelldichte (ECD) von Spenderhornhäuten beeinflussen, sondern fokussiert auch auf einen bislang eher am Rande betrachteten Parameter: die Zeit zwischen Tod und Gewebeentnahme (death-to-retrieval time [DRT]). Mit einer medianen DRT von lediglich zwei Stunden und 29 Minuten (!) präsentiert die israelische Kohorte einen Wert, der im internationalen Vergleich außergewöhnlich kurz ist und damit die Hypothese aufwirft: Könnte eine konsequente Verkürzung der DRT die Qualität von Spenderhornhäuten weiter messbar verbessern?
Während die multivariable Analyse erwartungsgemäß Alter und Linsenstatus als stärkste unabhängige Prädiktoren für eine ausreichende ECD identifizierte, zeigte sich für die DRT zumindest ein vielversprechender Trend. Hornhäute, die innerhalb von vier Stunden nach dem Tod entnommen wurden, erreichten in 83 Prozent der Fälle die lokale Eignungsschwelle, verglichen mit 75 Prozent bei längerer DRT. Auch wenn dieser Unterschied statistisch nicht signifikant war, ist er biologisch plausibel. Denn die Integrität des Hornhautendothels hängt unmittelbar von der postmortalen Hypoxie und dem metabolischen Stress ab, denen das Gewebe bis zur Entnahme ausgesetzt ist.
Vergleichbare Studien aus Europa und Nordamerika zeichnen bislang ein anderes Bild. So zeigte eine große deutsche Analyse im Rahmen des DGFG-Netzwerkes, dass selbst bei DRTs von bis zu 48 Stunden noch eine hohe Transplantationstauglichkeit erreicht werden konnte. Auch dänische Registerdaten zu mehr als 3000 Hornhäuten fanden keinen signifikanten Einfluss von DRT oder „death-to-preservation time“ auf die Eignung für Keratoplastiken. Diese Ergebnisse haben dazu geführt, dass die europäischen Richtlinien eine DRT von bis zu 72 Stunden als akzeptabel definieren. Vor diesem Hintergrund ist die israelische Studie besonders interessant: Sie deutet an, dass eine Verkürzung der DRT zwar nicht zwingend notwendig ist, um transplantierbares Gewebe zu gewinnen, aber möglicherweise einen zusätzlichen Qualitätsvorteil bringen könnte – insbesondere in Settings, in denen höchste Ansprüche an die Endothelzellzahl gestellt werden.
Die Stärke der Arbeit liegt also nicht allein in der Bestätigung bekannter Risikofaktoren wie Alter und Kataraktstatus, sondern in der Aufwertung eines organisatorischen Parameters, der bislang wenig Beachtung fand. Die extrem kurze DRT ist weniger ein biologisches Faktum als vielmehr das Resultat effizienter Strukturen: kurze Wege, schnelle Alarmierung und hohe Priorisierung der Hornhautentnahme im klinischen Ablauf. Damit verweist die Studie auf eine Dimension, die über die reine Biologie hinausgeht: die Logistik. In diesem konkreten Fall ist sie gegebenfalls auch „begünstig“ durch die aktuelle (Konflikt-)Situation in Israel.
Kombinierte Keratoplastik und Vitrektomie bei infektiöser Keratitis mit Endophthalmitis – ein Balanceakt zwischen Augenerhalt und Enukleation
Zum Abschluss noch eine retrospektive Analyse, die sich dem Thema Keratoplastik im „Katastrophenszenario“ widmet. In dieser Studie einer deutschen universitären Einrichtung wurden 129 Augen untersucht, die zwischen 2016 und 2024 mit einer kombinierten perforierenden Keratoplastik (PKP) und Vitrektomie (VR) versorgt wurden. Bei der initialen OP-Indikation waren jeweils 50 Prozent der Fälle infektiös (IKE) bzw. 50 Prozent nicht infektiös verursacht. Die positiven Ergebnisse zuerst: Ein verbesserter Visus von logMAR 2,3 auf 2,0 konnte für die Kohorte erreicht werden. Die Rate schwerer Sehbehinderung sank von 97 auf 86 Prozent. Auch im Vergleich zu vorangegangenen Studien konnte mit einem Augenerhalt von 93 Prozent (4% Phthisis bulbi) ein vergleichsweise gutes Ergebnis erreicht werden. Interessant sind die Ergebnisse beim Vergleich. Patienten mit Infektion vs. nicht infektiös: Die „Infekt‑Gruppe“ wies einerseits eine höhere Enukleationsrate auf, andererseits aber auch eine höhere Wahrscheinlichkeit signifikanter Visusverbesserung. Nicht unerwartet waren zusätzliche Eingriffe bei der IKE-Gruppe notwendig. Amnionmembran-Transplantationen und Glaukom-Eingriffe wurden postoperativ signifikant häufiger durchgeführt. Diese ambivalente Bilanz verdeutlicht: PKP-VR kann bei Infektion als unverzichtbares Verfahren gelten, das einerseits das Risiko des Augenverlusts birgt, andererseits aber auch die einzige Chance auf funktionelle Rehabilitation darstellen kann. Die Autoren plädieren für eine frühe Indikationsstellung: Je früher die Entscheidung zur kombinierten Operation fällt, desto größer die Chance, Infektion und Entzündung zu kontrollieren. Als Prognosemarker sind vor allem Befunde der Retina zu nennen: retinale Infiltrate, Blutungen und Ischämien waren signifikant mit einem schlechteren Outcome assoziiert. Diese Parameter sollten in die präoperative Aufklärung einfließen. Schade, dass weitere Komorbiditäten wie ein Diabetes oder auch Autoimmunerkrankungen hier nicht in der Analyse einbezogen wurden.
Lassen Sie mich resümieren: Die Beteiligung der Kornea bei Diabetes ist oft subtil und wird vermutlich oft übersehen – kann jedoch zu weitreichenden Problemen führen. Für die Praxis gilt es daher, bei der zunehmenden Zahl von Diabetikern vigilant zu bleiben.
In diesem Sinne verbleibe ich
Ihr Uwe Pleyer, zusammen mit dem Team von KOMPAKT OPHTHALMOLOGIE