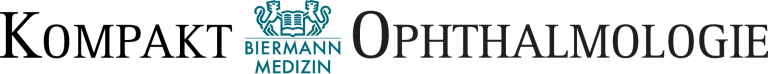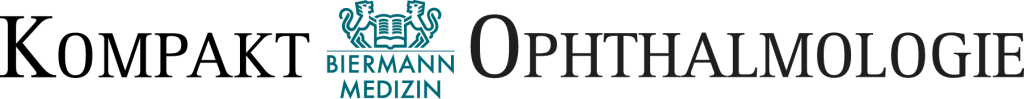Ein Unglück kommt selten allein ….

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es brennt auf den Nägeln und, ja – es kann auch ins „Auge gehen“… COVID-19…
Aktuell kommen wir um eine Stellungnahme zur Coronavirus-Epidemie nicht herum und leiten damit die aktuelle Ausgabe von „Kompakt“ ein. Wir erinnern uns: Erste Warnungen gingen bereits im Dezember letzten Jahres von einem Augenarzt aus. Unser Kollege Li Wenlian/Wuhan – der das Virus von einem (asymptomatischen) Glaukompatienten übertragen bekam, wurde dabei tragischerweise gleich zweimal vom Unheil verfolgt. Erst wurden seine Warnungen nicht nur ignoriert und abgetan, sondern er wurde verwarnt und dafür öffentlich diskreditiert. Später fiel er dann selbst der eskalierenden Infektion zum Opfer und verstarb. Als Kollegen können wir seinem Engagement nur mit größtem Respekt begegnen.
Gleichzeitig führt uns dies überdeutlich vor Augen, in welcher Risikosituation wir uns gerade als Augenärzte befinden. Die Erreger verbreiten sich überwiegend als Mikroaerosol in einem Umkreis von bis zu 1–1,5 m. Eine hohe Patientendichte und ein sehr enger Patientenkontakt an der Spaltlampe erhöhen das Risiko. Natürlich werden wir künftig nicht auf Ophthalmoskopie und Spaltlampenuntersuchung verzichten – aber die Frage stellt sich schon: Wie vorbereiten? Wie können wir uns schützen? Daher sei schon jetzt auf den Beitrag von Lai TH und Mitarbeitern aus Hong Kong hingewiesen, die in einer aktuellen Ausgabe des Graefe Arch Ophthalmol berichten (in press) werden. In einem Drei-Punkte-Plan fassen sie Empfehlungen zusammen, die sie aus ihren Erfahrungen in einem unmittelbar betroffenen Endemiegebiet weitergeben können. Diese gehen doch noch über die Maßnahmen hinaus, die wir im Zusammenhang mit Adenovirus-Ausbreitungen bereits kennen. Da dieses Manuskript sich noch „in press“ befindet, vorab bereits einige Auszüge in Kürze:
Erstens: Das Expositionsrisiko möglichst gering halten! Konkret: Personen aus Endemiegebieten mit unklarem Fieber und Atemwegsproblemen sollten bereits im Vorfeld bei der Anmeldung identifiziert werden. Ophthalmologische Untersuchungen sollten dann möglichst um 14 Tage verschoben werden.
Zweitens: Um die Transmission via Aerosol zu vermindern sollten Spaltlampen mit Schutz- schilden versehen werden; zwischen jedem Patienten sollte eine Wischdesinfektion von Kinn- und Stirnkontaktflächen sowie eine häufige Desinfektion von Gebrauchsmaterialien, Türklinken, Aufzugknöpfen etc. erfolgen. Schließlich haben Untersuchungen gezeigt, dass
Coronaviren an Metall- und Kunststoff Oberflächen ca. 7–9 Tage persistieren aber z.B. mittels 1%iger jodhaltiger Lösungen in 2 Minuten eradiziert sind.
Drittens: Strikte, häufige Handhygiene sowie gegebenenfalls Mundschutz sowie Schulung und Information des Mitarbeiterpersonals.
Bislang ist zwar noch ungesichert ob auch die neue Virusvariante im Tränenfilm nachweisbar ist. Der Vergleich mit dem 2003 isolierten SARS-Coronavirus, bei dem der Nachweis gelang, liegt aber nahe. Zudem wurden Konjunktivitiden als Erstbefund vor Ausbruch der generalisierten Infektion in Einzelfällen beschrieben. Daher werden Maßnahmen wie bei Adenoviren z.B. bezüglich der (Kontakt-)Tonometrie empfohlen. Entgegen einer weitverbreiteten Annahme bietet allerdings gerade die Non-Kontakt-Tonometrie keine sichere Alternative, sondern ist durch den Luftstoß gut geeignet der aerogenen Virusausbreitung eher Vorschub zu leisten. Daher wird von den Autoren eher eine I‑care-Tonometrie oder Goldmann-Applanation mit Einmal-Köpfchen empfohlen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das volle Maßnahmenpaket nicht notwendig und sicherlich auch nicht einfach umsetzbar. Wenden wir uns noch einem weiteren Thema zu, das für die Betroffenen ebenfalls eine doppelte Belastung darstellt. Es betrifft die zunehmende Zahl onkologischer Patienten. Tumorneuerkrankungen betreffen ca. 500.000 Patienten/Jahr und führen bei ca. 200 000 Menschen in Deutschland jährlich zum Tod. Wir hatten eine erhöhte Vigilanz der Augenärzte für das Thema bereits angesprochen. Nahezu spektakuläre Erfolge konnten in den letzten Jahren in der Onkologie nicht nur mit Checkpoint-Inhibitoren (erkennbar durch die Endsilbe „-mab“ im Namen), sondern auch mit selektiven MAP-Kinase-Inhibitoren (MEKi; erkennbar durch Endsilbe „-nib“) erreicht werden. Selbst bei bisher als unbehandelbar geltenden Malignomen kann damit eine deutlich bessere Prognose erreicht werden. Es kann z.T. von „Heilung“ gesprochen werden.
Mit der zunehmend häufigeren Anwendung dieser hochpotenten Wirkstoffe rücken auch die unerwünschten Wirkungen deutlicher in den Vordergrund. Dabei sind viele Nebenwirkungen von den gleichen immunologischen Mechanismen getrieben, die für die Wirkung der Substanzen verantwortlich sind. Entsprechend ihres Wirkansatzes induzieren Immuncheckpoint-Inhibitoren v.a. autoimmune Nebenwirkungen, die jedes Organsystem einbeziehen können. Häufig betroffene Organe sind Haut- und Schleimhaut (Kolitis, Konjunktivitis), endokrine Organe (Thyreoidea oder Hypophyse), sowie neurologische Nebenwirkungen, die v.a. auch das Auge einbeziehen. Damit unterscheiden sich die
Nebenwirkungen grundlegend von den bisher bekannten zytotoxischen Effekten konventioneller Chemotherapien oder strahlentherapeutischer Komplikationen.
Der Beitrag von Fang T et al. im „Journal of Current Ophthalmology” fasst die bisherigen Beobachtungen zu Checkpoint-Inhibitoren aus dem Melderegister der FDA zusammen. Die Prävalenz okulärer Nebenwirkungen liegt zwar im einstelligen Prozentbereich. Die Autoren gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, da wenig ausgeprägte Nebenwirkungen selten geäußert werden. Zudem besteht auch die Sorge, die lebensverlängernde Therapie könne aufgrund unerwünschter Wirkungen vorzeitig beendet werden. Am häufigsten war Ipilimumab auffällig. Als CTLA-4-Hemmer beeinträchtigt es v.a. die Funktion von T‑regulatorischen Zellen, und führt zu entsprechenden (auto)immunologischen Veränderungen, v.a. entzündlichen Darmerkrankungen und unterschiedlichen Formen der Uveitis.
Da konkrete Handlungsanweisungen in dieser Arbeit nicht gegeben werden, weisen wir ergänzend auf den Übersichtsbeitrag von Liu X et al. (Peking) hin. Er ist zwar in einer nicht ophthalmologischen Zeitschrift („Thoracic Cancer”) zu finden, aber im Open Access universell verfügbar. Hier werden in knapper, fokussierter Darstellung nicht nur das deutlich weitere Spektrum ophthalmologischer Komplikationen (kurz) angesprochen, sondern auch die bisherigen berichteten Behandlungsansätze prägnant zusammengefasst.
Ebenfalls deutlich lebensverlängernd wirken sogenannte selektive MEK-Inhibitoren, die v.a. beim malignen Melanom verwendet werden. Unerwünschte Wirkungen werden in klinischen Studien bei bis zu 90 % (!) der Patienten beobachtet. Méndez-Martínez S et al. stellen in „Retina” eine systematische Analyse der wesentlichen Komplikationen zusammen. Makulaödem, Abhebung des retinalen Pigmentepithels (RPE), retinaler Venenverschluss und RCS-ähnliche Veränderungen stehen im Fokus des Nebenwirkungsspektrums. Dabei treten einige interessante pathophysiologische Aspekte zu Tage. Abweichend von den Veränderungen der oben genannten Checkpoint-Inhibitoren kann bei MEK-Inhibitoren ein „Klasseneffekt“ mit charakteristischer Netzhauttoxizität beobachtet werden. Dazu wurde der Begriff „MEK-assoziierte Retinopathie“ (MEKAR) geprägt, der dosis- und zeitabhängige Netzhautnebenwirkung zeigt. Verkürzt dargestellt treten klinische Veränderungen wie bei der RCS auf. Visusminderung, Metamorphopsien und Farbsinn-Störungen sind die häufigsten Symptome. Als Unterschiede stellen die Autoren heraus, dass medikamenteninduzierte Veränderungen sehr viel häufiger bilateral (90 % vs. max 40 % bei RCS), multifokal (bei 77% !) und zudem oft extra-foveal zu finden sind. Auch die OCT-Darstellung unterscheidet sich. In allen MEKAR-Fällen fanden sich Flüssigkeitsansammlungen zwischen dem RPE und der Interdigitalisierungszone, einem Bereich, der die apikalen Prozesse des RPE und der äußeren Zapfensegmente umfasst.
Alle diese Befunde sprechen dafür, dass bei der MEK-Hemmung eine veränderte Flüssigkeitsverteilung erfolgt und vermutlich die Tight-Junctions zwischen RPE-Zellen verändert werden.
Als Resümee der Behandlung mit diesen neuen immun-onkologischen Wirkstoffklassen lässt sich folgern, das idealerweise eine ophthalmologische Untersuchung bereits vor Therapiebeginn erfolgt. Damit können gegebenenfalls vorbestehende Veränderungen von dem breiten Spektrum unerwünschten Wirkungen unterschieden werden. Unsere exzellenten Möglichkeiten v.a. retinotoxische Effekte z.B. per OCT aufzuspüren, sollten häufiger angewendet werden. Bisherige Behandlungsmöglichkeiten sind zwar unspezifisch (Steroide…), aber durchaus effektiv und sollten die Lebensqualität der ohnehin schwer betroffenen Patienten nicht noch durch Visus-gefährdende Komplikationen einschränken.
Bleiben sie gesund und aufmerksam!
Herzlichst Ihr Uwe Pleyer und das Team von „Ophthalmologie Kompakt”