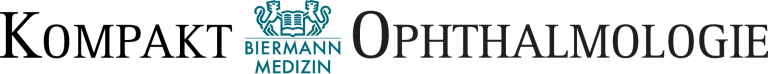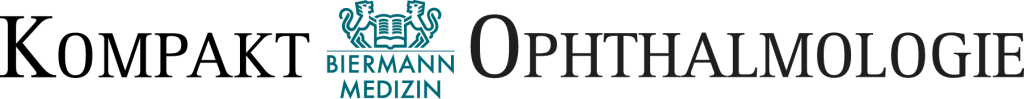Diabetes und Auge: Bewährtes. Neues. Überraschendes.

Aktuell sind mehr als 460 Mio. Menschen von Diabetes mellitus betroffen – eine Zahl, die sich bis 2045 auf 700 Mio. nahezu verdoppeln wird. Gleichzeitig schätzt die International Diabetes Federation (IDF) das ca. 3% der Betroffenen erblinden werden. Zwei Komplikationen bedrohen das Sehvermögen: das diabetische Makulaödem und die proliferative diabetische Retinopathie. Für beide Probleme ist die pathogene Rolle von VEGF gut etabliert. Die Bedeutung und der Nutzen der Behandlung des diabetischem Makulaödem mit VEGF-Hemmer ist längst unbestritten. Inzwischen zeichnet sich ab, das sie auch bei anderen Formen der diabetischen Retinopathie ein wichtiger Baustein individualisierter Therapie werden können. Dies belegen aktuelle Daten der PANORAMA-Studie. In der aktuellen Online-Mitteilung von „JAMA Ophthalmology“ werden die Daten von mehr als 400 Diabetikern vorgestellt, die Aflibercept erhielten. Die Ergebnisse nach 2 Jahren belegen signifikante, positive Effekte mit Regression der morphologischen Befunde, die mit einem verbesserten funktionellen Ergebnis einhergehen. Gleichzeitig trat seltener als in der Kontrollgruppe ein Makulaödem auf. Wie die Autoren betonen, war der Behandlungserfolg von einer konsequent fortgeführten Injektionsfrequenz über das erste Jahr hinaus abhängig.
Dies setzt eine gute Adhärenz der Patienten in der Langzeitbehandlung voraus – eine Voraussetzung, an der langfristige Erfolge, gerade bei Diabetikern, leider oft scheitern. Dass die Augenproblematik im Bewusstsein der Betroffenen oft nicht „ankommt“, geht aus dem aktuellen Beitrag von Nwanyanwu und Mitarbeitern hervor. Kurz zusammengefasst: Jedem 10. Patienten mit diabetischer Retinopathie war die Erkrankung nicht bekannt. Besonders negativ fiel dabei die Gruppe der älteren Männer auf. Als Grundlage für die Diagnose und Graduierung der Retinopathie bei dieser Studie wurden vor allem Fundusaufnahmen herangezogen.
Fundusaufnahmen haben sich bereits als gut geeignete Möglichkeit für ein automatisiertes, zeitsparendes Screening herausgestellt. Wir hatten bereits darauf hingewiesen (Kompakt Ophthalmologie, Januar 2020), dass die FDA einem Unternehmen für künstliche Intelligenz die Genehmigung für sein „Eyenuk“-System zu diesem Zweck erteilt hat. Lässt sich dies noch verbessern? Da die OCT-Untersuchung bei Diabetikern vielerorts zum Standard wurde und erheblich mehr und detailliertere Daten liefert, bietet sie sich zur Frühdiagnostik an. Neue Erkenntnisse dazu bietet die Arbeit von Papay JA et al., nachzulesen in „PLoS One“. Diese Studie an 33 Diabetikern belegt, dass spezifisch aufgearbeitete OCT-Signale sehr frühzeitig morphologische Veränderungen erfassen können. Musterveränderungen wurden v.a. in den äußeren Netzhautschichten nachgewiesen, die mit Anomalien kleiner Gefäße und Exsudation von Lipiden und Flüssigkeit übereinstimmten. Die Autoren betonen, das andere pathologische Prozesse, die im Alter häufiger auftreten, weitgehend aus der Analyse ausgeschlossen werden konnten. Da es sich um eine Pilotstudie mit einer kleinen umschriebenen Kohorte handelt, sind weitere Untersuchungen und unabhängige Bestätigung der Ergebnisse abzuwarten.
Uns ist allen klar, dass zwischen der Mikroangiopathie der Retina und pathologischen Befunden an anderen Organen enge Verbindungen bestehen. Aber: Wie steht es mit einer möglichen Korrelation zur Chorioidea? Francisco de Asis Bartol-Puyal und Kollegen aus Spanien haben sich diese Frage gestellt und eine sorgfältige interdisziplinär angelegte Untersuchung vorgelegt. In der aktuellen Ausgabe des „European Journal of Ophthalmology“ stellen sie ihre Ergebnisse vor. Kurz zusammengefasst: Erwartungsgemäß bestätigt sich der Zusammenhang der Retinopathie mit einer Mikroangiopathie als Nephropathie und korreliert mit der peripheren Polyneuropathie. Allerdings ließ sich keine Beziehung zu einer extraokularen (systemischen) Makroangiopathie herstellen.
Die Mikroangiopathie an Niere und Myokard bei Diabetikern ist gut bekannt – weniger beachtet werden Veränderungen im zentralen Nervensystem. Ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle bei Patienten mit proliferativer diabetischer Retinopathie ist belegt. Aktuelle Ergebnisse aus Helsinki (Finnland) zeigen, dass zerebrale Veränderungen schon sehr viel früher als Mikroblutungen auftreten. Bereits bei moderater diabetischer Retinopathie (EDTRS <35) konnten diese nachgewiesen werden. Auch nach Ausschluss weiterer Risikofaktoren, z.B. arterieller Hypertension, erwies sich die Retinopathie als unabhängiger Risikofaktor (8- bis 38-fach erhöht).
Zu guter Letzt noch eine Mitteilung, die mich doch überrascht hat … Eine aktuelle Kooperation chinesischer und dänischer Kollegen zeigt, dass ein mütterlicher Diabetes mellitus während der Schwangerschaft mit einem verstärkten Risiko für hohe Refraktionsfehler bei den Nachkommen assoziiert ist. Dazu wurden die Daten von nicht weniger als 2,5 Mio. Personen herangezogen. Bemerkenswert ist auch, das diese über 25 Jahre nachverfolgt wurden. Zusammenfassend wird berichtet, dass mütterlicher Diabetes mit einem 39-fach stärkeren Risiko für hohe Brechungsfehler bei den Kindern verbunden ist: Ein Effekt, der noch stärker bei Müttern mit diabetischen Komplikationen während der Schwangerschaft ausgeprägt war. Über die Genese dieser Beobachtung können die Autoren nur spekulieren. In erster Linie führen sie metabolische Veränderungen des Fetus an. Als Konsequenz empfehlen die Kollegen ein frühzeitiges ophthalmologisches Screening bei Kindern von Müttern, bei denen vor oder während der Schwangerschaft ein Diabetes diagnostiziert wurde.
Fazit aus all diesen Beobachtungen: Aktuelle Prognosen lassen erwarten, dass der Diabetes ein zunehmendes Problem für die Weltbevölkerung wird. Chronische Komplikationen der Erkrankung werden für Patienten, Ärzte und die Gesellschaft als Ganzes von großer Bedeutung sein, auch in Hinblick auf eine wirtschaftliche und globale Gesundheitsperspektive. Die diabetische Retinopathie als eine der häufigsten und schwerwiegendsten Komplikationen wird sich nur durch effektive Früherkennung und adäquates Handeln eingrenzen lassen. Die Voraussetzungen dazu waren noch nie so günstig.
Wir werden das Thema im Auge behalten und bei anderer Gelegenheit in Kompakt Ophthalmologie wieder berichten.
Herzlichst,
Ihr Uwe Pleyer und das gesamte Team von „Kompakt Ophthalmologie“