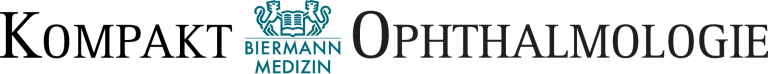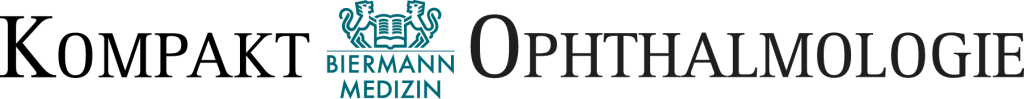Liebe Leserinnen und Leser von Kompakt Ophthalmologie,
im Norden Deutschlands erleben wir gerade einen durchwachsenen Sommer. Gerade, wenn man hier oben Urlaub macht, muss man sich des Risikos bewusst sein. Es kann leider immer mal passieren, dass der Urlaub ins Wasser fällt. Wenn man darauf vorbereitet ist, gibt es aber immer viele Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen.
Genauso ergeht es uns in der Chirurgie mit möglichen Komplikationen. Glücklicherweise sehen wir in der modernen Augenchirurgie nur selten intra- und postoperative Komplikationen. Insbesondere visusbedrohende Situationen treten selten ein. Dennoch ist es wichtig, sich immer der Möglichkeit von Problemen bewusst zu sein und sein Handeln immer zu hinterfragen. Besonders bei Änderungen des therapeutischen Vorgehens besteht immer ein erhöhtes Risiko. Schauen wir uns daher einmal einige Arbeiten über die Sicherheit und Therapiealternativen in der Augenheilkunde an.
Kang et al. veröffentlichten kürzlich in „Graefe´s Archive of Clinical Experimental Ophthalmology“ eine interessante Arbeit über Risikomodelle. Sogenannte Risikostratifizierungsmodelle können Kataraktchirurgen bei klinischen Entscheidungen helfen, indem sie Patienten anhand ihrer Komplikationswahrscheinlichkeit in verschiedene Gruppen einteilen. In einem systematischen Review untersuchen die Autoren Merkmale, welche von diesen Modellen für Kataraktoperationen in der Literatur genutzt werden.
Anhand der Leitlinien für systematische Reviews und Metaanalysen durchsuchten die Autoren sechs Datenbanken (PubMed, OVID, Embase, CINAHL, Cochrane Trials und Web of Science) und schlossen Peer-reviewte englischsprachige Studien ein, die Modelle beschreiben, welche präoperativ zur Beurteilung der Komplikationswahrscheinlichkeit bei Kataraktoperationen verwendet wurden. Zur Analyse erstellte man eine Checkliste aus drei Rahmenbedingungen, um die Teilnehmer, Prädiktoren und das Bias-Risiko der Modelle kritisch zu bewerten. Von 4192 Artikeln erfüllten nur acht die Einschlusskriterien. Die meisten Modelle waren ausschließlich für Operateure und für die Phakoemulsifikation zur Vorhersage von Zonulakomplikationen und einer Hinterkapselruptur konzipiert. Die häufigsten in den Modellen identifizierten Risikofaktoren waren eine schlechte Patientenlagerung, hohes Alter, kleine Pupillen und das Pseudoexfoliationssyndrom. Neben den uns allen bekannten und häufigsten Risikofaktoren wurden also keine zusätzlichen Informationen detektiert. Methodische Einschränkungen umfassten das Fehlen multivariabler Modellierung, standardisierter Ergebnismaße und externer Validierung.
Augenärzte sollten folglich die Grenzen von Risikostratifizierungsmodellen für Kataraktoperationen kennen. Des Weiteren sollten wir in der Zukunft daran arbeiten, bestehende Modelle, durch robustere, verbesserte Methoden, die Verwendung standardisierter Metriken und eine externe Validierung zu verbessern. Dies sollte es uns ermöglichen, neben den bekannten Risikofaktoren weitere aufzuzeigen und somit die Sicherheit unsere Therapie zu erhöhen.
Um das Thema Sicherheitsbewertung gängiger Therapien geht es auch in einer Publikation von Bektas und Yuksel aus dem Journal „International Ophthalmology“. Die Autoren führten einen Review der Literatur bezüglich der Indikationen, Dosierungen und Sicherheitsprofile intrakameraler Medikamente bei Kataraktoperationen durch. Sie werteten veröffentlichte klinische Studien, Übersichtsartikel und Leitlinien zur intrakameralen Medikamentenanwendung aus. Die Analyse konzentrierte sich auf Medikamente, die üblicherweise zur Anästhesie, Mydriasis, Entzündungskontrolle und zum Management intraoperativer Komplikationen eingesetzt werden. Besonderes Augenmerk wurde auch in dieser Arbeit auf ihren Nutzen in den bekannten risikoreichen Operationsszenarien gelegt, wie z. B. bei kleinen Pupillen, intraoperativem Floppy-Iris-Syndrom, fortgeschrittener oder kindlicher Katarakt und Zonulaschwäche. Besondere chirurgische Kolibris bei denen intrakamerale Medikamente genutzt werden, konnten die Autoren nicht finden. Intrakamerale Medikamente haben sich in zahlreichen Publikationen als hilfreich erwiesen, um z.B. eine effektive Anästhesie zu erreichen, die Pupillenerweiterung aufrechtzuerhalten und Entzündungen besser zu kontrollieren. Ihr Einsatz ist besonders vorteilhaft in komplexen Fällen, wie hinterer Kapselruptur oder kombinierten Eingriffen wie minimalinvasiver Glaukomchirurgie. Gerade bei unerwartet langen Operationen kann die intrakamerale Injektion von Anästhetika und pupillenerweiterten Medikamenten extrem hilfreich sein, um die Operation optimal zu beenden und so angenehm wie möglich für den Patienten zu gestallten. Oftmals werden im klinischen Alltag diese Medikamente kurzfristig im OP angemischt. Fertige Produkte sind häufig sehr kostenintensiv oder stehen nicht überall zur Verfügung. Bei sachgemäßer Zubereitung und Verabreichung tragen die angemischten Medikamente zu sichereren und effizienteren Operationen bei, eine unsachgemäße Zubereitung oder Dosierung kann jedoch zu okulärer Toxizität führen. Die Schulung des Personals bezüglich der richtigen Dosierung und Hygiene während der Zubereitung der Medikamente ist als von großer Bedeutung um die Sicherheit von intrakameralen Injektionen zu gewährleisten.
Intrakamerale Medikamente haben auch das Potenzial, die Tropfengabe nach augenärztlichen Operationen zu reduzieren oder gar zu ersetzen. Dies würde die postoperative Behandlung für die Patienten erleichtern, könnte Probleme wie das induzierte Sicca-Syndrom und möglicherweise auch Kosten reduzieren. Huang et al. beschäftigten sich hierzu mit dem spannenden Thema der „dropless“ Kataraktchirurgie.
Die postoperative Tropfengabe gehört im Rahmen der Kataraktoperation immer noch zum weltweiten Goldstandard. Einheitliche, gesicherte Leitlinien liegen aber nicht vor. Oftmals führen komplexe postoperative Behandlungsschemata und eine schlechte Compliance zu Problemen. Ein Ersatz von Tropfen durch intraoperativ verabreichte Medikamente könnte hier von Nutzen sein. Bekannt ist zum Beispiel der Einsatz von steroidhaltigen Punctum Plugs, welche postoperative Entzündungen reduzieren können. Alternativ können aber auch am Ende der Operation Medikamente injiziert oder medikamentenfreisetzende Implantate eingesetzt werden. Intrakamerale Medikamentengaben haben also nicht nur das Potenzial, intraoperativ komplexe Fälle zu erleichtern, sondern auch, die postoperative Behandlung zu optimieren. Die Autoren konzentrierten sich in dem Review auf häufig verwendete Medikamente wie Antibiotika, Steroide, nichtsteroidale Antirheumatika und Medikamente zur Senkung des Augeninnendrucks. Die intrakamerale Gabe von Antibiotika ist weit verbreitet und hat sich als Goldstandard etabliert. Es gibt überzeugende Belege dafür, dass sie das Risiko für eine postoperative Endophthalmitis wirksam reduziert, ohne dass zusätzliche topische Antibiotika erforderlich sind. Hier wäre es wichtig einheitliche Standards zu etablieren. Ist die postoperative Gabe antibiotischer Augentropfen überhaupt noch notwendig? Hierzu wird auf Kongressen immer wieder diskutiert, ohne dass es zu einem einheitlichen Standard kommt. Steroide, die intraoperativ typischerweise durch subkonjunktivale Injektionen oder Implantate mit verzögerter Wirkstoff-Freisetzung verabreicht werden, sind vielversprechend für die sichere und wirksame Kontrolle von Entzündungen. Nichtsteroidale Antirheumatika und Medikamente gegen Augeninnendruck kommen im klinischen Alltag noch selten zur Anwendung und daher gibt es hier auch weniger Literatur. Folglich ist für diese Medikamentengruppen eine Bewertung in Hinblick auf eine tropfenlose Behandlung noch nicht abschließend möglich.
Die Autoren sehen nach ihrer Recherche in der tropfenlosen Kataraktoperation eine zukunftsweisende Therapie, welche die postoperative Versorgung vereinfachen, Kosten senken und auch weniger Abfall produzieren könnte. Es ist also wichtig, durch zukünftige Forschung die Bewertung echter tropfenloser Ansätze und die Optimierung der Medikamentenverabreichung zu evaluieren und weltweit gängige Standards zu etablieren, da die tropfenlose Kataraktoperation viele potenzielle Vorteile für Patienten, Gesundheitssysteme und die Umwelt mit sich bringt.
Ob ein Medikament intravitreal oder subkonjunktival verabreicht wird, hat bezüglich der Sicherheit natürlich erhebliche Bedeutung. Couret et al. untersuchten diesbezüglich die Sicherheit und Effizienz von der subkonjunktivalen Steroidgabe im Vergleich zur intravitrealen Gabe in der Therapie des uveitischen und postoperativen Makulaödems. Die Studie wurde kürzlich im „British Journal of Ophthalmology“ publiziert.
Ziel der retrospektiven Studie war der Vergleich der Wirksamkeit von subkonjunktivalen Triamcinolonacetonid-Injektionen und intravitrealen Injektionen von 700 µg Dexamethason-Implantaten zur Reduktion der zentralen Makuladicke (CMT) bei uveitischem und postoperativem Makulaödem (ME). In der multizentrischen, randomisierten Vergleichsstudie wurden die Patienten im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder Triamcinolon oder Dexamethason. Primärer Endpunkt war die Differenz der CMT der behandelten Augen zwischen Studienbeginn und bis zu drei Monaten nach der Gabe. Sekundäre Endpunkte umfassten u.a. die Sehschärfe, Glaskörpertrübungen, Wirkdauer, Verträglichkeit der Injektionen und Nebenwirkungen.
Es wurden 106 Patienten in die Studie aufgenommen und es zeigte sich, dass subkonjunktivale Injektionen der intravitrealen Injektionen insbesondere im dritten Monat nicht unterlegen waren. Es gab außerdem keinen signifikanten Unterschied beim Auftreten von Nebenwirkungen. Die Autoren folgerten aus ihren Ergebnissen, dass die subkonjuktivale Injektion eine sinnvolle Alternative zur Intravitrealen Dexamethason Injektion darstellt. Außerdem stellten sie heraus, dass der Therapiebeginn mit einer subkonjunktivalen Injektion bei einem schlechten Ansprechen nicht die Option einer Umstellung auf eine intravitreale Injektion verschließt. Sollten wir also zunächst immer mit subkonjunktivalen Injektionen beim postoperativen und uveitischen Makulaödem starten? Weitere Studien und Leitlinien könnten hier sehr hilfreich sein und helfen Risiken zu minimieren, Praxisabläufe zu vereinfachen und Kosten zu reduzieren.
Die vorgestellten Publikationen zeigen, wie auch in unseren sehr häufig vorkommenden Therapiefeldern Standards noch zu hinterfragen und weitere Optimierungen möglich sind. Die Medizin bleibt im Wandel genau wie das Wetter.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Sommer.
Ihr Detlef Holland